|
Bahnanlagen
in Groß-Lichterfelde und im früheren Landkreis
Teltow |
 Der
ehemalige Landkreis Teltow
Der
ehemalige Landkreis Teltow |
|
 
Karte des Kreises
um 1788
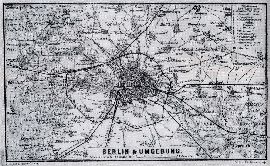 
Berlin um 1885
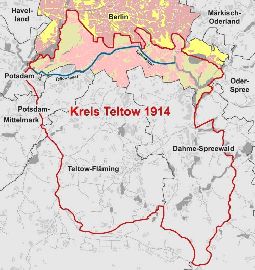 
|
Teltow ist der Name einer historischen
Landschaft in Berlin und Brandenburg, einer
geologischen Hochfläche, eines Landkreises und einer
Stadt an der südenwestlichen Stadtgrenze von Berlin.
Der Teltow ist eines der Kerngebiete Brandenburgs.
.Zum Teltow gehört auch das
Tempelhofer Oberland (siehe
hierzu auch.
 Teltow (Landschaft)
und
Teltow (Landschaft)
und
 Landkreis Teltow ,
Landkreis Teltow ,
 Stadt
Teltow ) Stadt
Teltow )
Der Landkreis Teltow umfasste das Gebiet
südlich der Spree Westlich an der Havel
entlang von Spandau über Potsdam an der Nuthe
entlang über Trebbin bis kurz vor Luckenwalde von
dort östlich bis südlich von Trebbin und Teupitz.
Östliche Grenze war die Spree, der Müggelsee, weiter
die Spree bis Gosen, Wernsdorfer See, dann südlich
Königswusterhausen oberhalb des Krüppelsee und dann
südlich bis Bucholtz. Der Landkreis war sehr
innovativ und entwickelte sich zu einem sehr
industriereichen Landkreis. Mit der Erlangung der
Kreisfreiheit seiner schnell wachsenden Städte in
der Nähe von Berlin verlor der Landkreis jedoch
immer wieder Bevölkerung und Wirtschaftskraft. Er
versuchte deshalb seine Gemeinden daran zu hindern
Stadtrecht zu erlangen, da meist anschließend diese
Städte versuchten kreisfrei zu werden. Deshalb
hatten Orte wie Steglitz (83.400 Einwohner) oder
Groß-Lichterfelde (47.400 Einwohner) kein
Stadtrecht, aber sehr viele Einwohner. Mit der
Gründung von Groß-Berlin 1926 (Teltow war
1920 nicht beigetreten) gingen dann endgültig über
90 % der Bevölkerung (ca. 450.000 Einw.) und fast
die gesamte Wirtschaftskraft des Landkreises
verloren. Zuvor waren schon die Städte
Charlottenburg (323.000 Einwohner), Wilmersdorf
(140.000 Einwohner), Schöneberg (178.000 Einwohner)
und Neukölln (262.000 Einwohner) als kreisfrei aus
dem Landkreis ausgeschieden (ca. 903.000 Einw.). Bis
dahin war jedoch im Landkreis sehr viel geschehen,
was später der Stadt Groß-Berlin zu gute kam. (siehe
zu Berlin auch:
 Alt-Berlin,
Alt-Berlin,
 Verband Groß Berlin
und
Verband Groß Berlin
und
 Groß-Berlin, sowie
Groß-Berlin, sowie
 Berlin und
Berlin und
 Größte Städte der EU
Größte Städte der EU
 Berliner Dialekt).
Trotz der Verluste von
Wirtschaftskraft an die Stadt Groß-Berlin war 1945
der Landkreis Teltow einer der reichsten Landkreise
des Deutschen Reiches. Da noch der Teilung
Deutschland viele Vermögenswerte im Westen lagen,
konnte er jedoch nicht mehr über diese verfügen.
Erst mit der Wiedervereinigung fiel dieses Vermögen
"Teltow-Vermögen"
den 1994 gebildeten 3 Landkreisen
Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und
Teltow-Flämig als Rechtsnachfolgern und Nutznießern
zu.
Berliner Dialekt).
Trotz der Verluste von
Wirtschaftskraft an die Stadt Groß-Berlin war 1945
der Landkreis Teltow einer der reichsten Landkreise
des Deutschen Reiches. Da noch der Teilung
Deutschland viele Vermögenswerte im Westen lagen,
konnte er jedoch nicht mehr über diese verfügen.
Erst mit der Wiedervereinigung fiel dieses Vermögen
"Teltow-Vermögen"
den 1994 gebildeten 3 Landkreisen
Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und
Teltow-Flämig als Rechtsnachfolgern und Nutznießern
zu.
Dem im Norden gelegenen
Landkreis Niederbarnim
(Teil des historischen Landkreises Barnim
(8arnimschen Kreis)) erging es ähnlich. Er besaß
jedoch nicht ganz die Wirtschaftskraft des
Landkreises im Süden Die gutbetuchten Bürger
lebten vor allem im Süden, die weniger Wohlhabenden
(vor allem Arbeiter) mehr im Norden von Berlin.
Groß-Lichterfelde lag um 1900 im Landkreis
Teltow und bestand aus den den historischen
Dörfern Lichterfelde und Giesensdorf und den
Villenkolonien Lichterfelde West und Lichterfelde
Ost sowie der Ortslage Schönow, die man sich
mit Zehlendorf teilte. Lichterfelde war zu dieser
Zeit ein Ort an dem jeder Einwohner die neuesten
Entwicklungen der Verkehrstechnik aus aller nächste
Nähe erleben und bewundern und teilweise auch
selber täglich testen konnte. Man musste also nicht
weit reisen, sondern konnte die neuesten Erfindungen
teilweise zu Fuß in Augenschein nehmen. Nicht nur,
dass hier der erste Mensch flog, auch die erste
elektrische Straßenbahn fuhr hier. Die ersten
Versuche mit elektrischen S-Bahntriebwagen und
mit Drehstromfahrzeugen fanden in Lichterfelde
statt. Ein großer Teil sogar im direkten Bereich der
Ortslage Lichterfelde West. Hier war also die Wiege
des elektrischen Betriebes der Eisenbahn. Auch wenn
es davon nichts mehr zu sehen gibt, Bahnanlagen in
Lichterfelde waren immer irgendwie interessant.
Einiges aus späteren Jahren ist noch irgendwo zu
finden, oft ist es jedoch nur mit sehr viel Mühe zu
entdecken. So gab es In Lichterfelde West gleich
mehre Bahnhöfe. So z.B. den S-Bahnhof, den
Personenbahnhof der Amerikaner (RTO) mit
Ladestrasse, einen Güterbahnhof (Übergabebahnhof zur
Goerzbahn) und lange Zeit noch die Reste des mit
Ende des Krieges stillgelegten Nordbahnhofes
(Personenbahnhof) der Goerzbahn. |
|
Viele
Firmen verlegten aus dem engen Berlin heraus ihre
Fabriken ins nahe Umland. Entlang des Teltow-Kanals
entstanden viele Fabriken. Im
Landkreis Teltow entstanden die
Lokomotivfabriken von O&K, Freudenstein und
Schwarzkopf. Siemens und die AEG erprobten
elektrische Eisenbahnen und die ersten
Motorflugzeuge waren auf dem Tempelhofer Feld und
dem ersten Deutschen Flugplatz Johannisthal zu
sehen. Die ersten O-Busse der Welt wurden in
Hallensee und Schöneweide erprobt. Auch die Gmd.
Steglitz probierte O-Busse aus. Im gesamten
Landkreis waren um 1900 die neuesten technischen
Entwicklungen zu sehen. Jeder Spaziergänger konnte
die Veränderungen sehen, sie geschahen vor seinen
Augen. Es waren nicht nur die Gründerjahre, sondern
auch grundlegende Entwicklungen und Erfindungen, die
hier in dieser Zeit geschahen und die bis heute
nachwirken. |
 Erster Flug
eines Menschen
Erster Flug
eines Menschen |
|

Otto Lilienthal
bei einem Gleitflug vom Lichterfelder Sprunghügel


Otto Lilienthal &
Gustav Lilienthal |
Otto Lilienthal
war - wie auch sein Bruder
Gustav Lilienthal
- Lichterfelder Bürger. Beide waren Flugpioniere.
Sie wohnten in Lichterfelde West. und Gustav
Lilienthal hinterließ als Architekt dort sehenswerte
Spuren. Seine Häuser in der Paulinenstraße sind
Legende. Auch Otto Lilienthals angeblich erste
Flugstätte ist als Denkmal erhalten. Diese Aussage
"erste Flugstätte" ist nicht ganz richtig, den
dieser Hügel war erst ab 1894 von im genutzt worden.
Zuvor war er von einem Sprungbrett im Garten und
dann ab 1891 auf einem Gelände am Mühlenberg bei
Derwitz (gehört zu Werder) gesprungen. Dann
unternahm er ab 1893 Flugversuche in einer Sandgrube
in den
Rauen Bergen in Steglitz =
„Steglitzer Fichtenberge“ in Südende an
der Bergstrasse (Nicht zu Verwechseln mit den
Rauen Bergen in etwas über 1
km Entfernung = Marienhöhe) Sein
Sprunghügel in Lichterfelde Süd wird heute von einem
Denkmal gekrönt. Der Berg entstand aus dem Abraum
eine Lehmgrube, die zu einer Ziegelei gehörte. Diese
dort gebrannten gelben Ziegel wurden in jenen Jahren
in Lichterfelde recht häufig verbaut. Ein Rest der
Grube ist heute als kleiner See vor den Denkmal
erhalten geblieben. Später genügte der Hügel nicht
mehr für die Flugversuche und Otto Lilienthal suchte
sich höhere Hügel in der Brandenburger Umgebung.
Später lag ab 1909 mit dem 2,1 km² großen
Flugplatz Johannisthal
der erste und damit älteste Deutsche Flugplatz im
Landkreis Teltow. 1923 nahm nicht weit entfernt der
Flughafen Berlin-Tempelhof
(damals noch im Landkreis Teltow liegend) seinen
Betrieb auf. Der Flugplatz Johannisthal wurde erst
1995 offiziell endgültig geschlossen, nachdem er
seit 1952 nicht mehr genutzt wurde. Er lag bis dahin
auf Ost-Berliner Gebiet. 1918 erfolgte vom nebenan
liegenden Tempelhofer Feld der erste Pasagierflug.
Der Flugplatz Tempelhof wurde 2008 geschlossen. |
.JPG)
Der Sprunghügel
heute
.JPG)
© 2011 Fotos
Winfried Meier |
|
Otto & Gustav
Lilienthal waren nicht nur Flugpioniere sondern auch
anerkannte Sozialreformer (1895 Gründung der
Baugenossenschaft „Freie Scholle“, sie existiert
heute noch in Bln. - Reinickendorf) und bereitetem
dem pädagogischen Spielzeug den Weg. Sie besaßen
zahlreiche Spielzeugpatente darunter das des spätere
Anker-Steinbaukasten
und des so genannten
Modellbaukasten
als Vorläufer der
Metallbaukästen
(z.B.
Stabilbaukasten der Fa.
Walter, Berlin
oder aktuell
METALLUS). |
|
 1881
Die erste elektrische Straßenbahn der Welt - Der
erste Triebwagen der Welt
1881
Die erste elektrische Straßenbahn der Welt - Der
erste Triebwagen der Welt |
|
 |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
|
Siemens hatte hier am 16. Mai 1881 die erste
elektrische Straßenbahn der Welt auf Meterspur mit
160 V Gleichstrom aus den Fahrschienen vom Bhf.
Lichterfelde Ost zur Kadettenanstalt in der
Finkenstein Allee (Lichterfelde West) in Betrieb
genommen. Siemens selbst betrachte sie als
elektrische Eisenbahn bzw. als Prototyp einer
Hochbahn. 1893 wurde die Bahn auf
Oberleitungsbetrieb und eine höhere Spannung
umgestellt und erweitert. Sie gehörte nun dem
Landkreis Teltow
(Teltower Kreisbahnen).
Die Straßenbahn erreichte seit 1890 auch den Bhf
Lichterfelde West und diente unter anderem auch
der Erschließung der gesamten Villenkolonie
Lichterfelde West. 1895 wurde das Netz durch den
Neubau der Strecken nach
Steglitz und von
Steglitz nach
Südende vergrößert
(Linie M,
später Linie 97). Da mit der Gründung von
Groß-Berlin das gesamte Netz auf Berliner Gebiet lag
übernahm 1921 die
Berliner Straßenbahn
das Netz. Am 9. Oktober 1925 wurde das gesamte
Schmalspurnetz stillgelegt und größtenteils durch
Normalspurstrecken ersetzt, die am 1. Januar 1929
zur BVG kamen. Ab 1930 übernahmen nach und nach
Busse den Gesamtverkehr. Die Siemens-Straßenbahn war
die Grundlage für die Entwicklung der U- und S-Bahn,
den sie war auch der erste elektrische Triebwagen
der Welt. Zu finden ist von der ersten Straßenbahn
der Welt nichts mehr. Nur noch das Depot der
Meterspurstraßenbahn ist noch vorhanden. Aber dieses
ist jüngeren Datums.
|
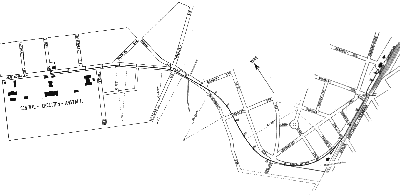
Bei der Strecke
handelte es sich um ein normalpuriges
Materialbahngleis, das für den Aufbau der
Central-Cadetten-Anstalt genutzt worden war und nun
auf Meterspur umgenagelt worden war. Zu finden ist
nichts mehr von der Strecke dieser Bahn. |
|

TM 24 |
Selbst die Spuren der späteren normalspurigen
Straßenbahnen sind in Lichterfelde nur für
Eingeweihte zu finden. So erkennt man z.B. in der
Ringstraße am Pflaster, wo die Gleise der
Linie 78
(Sie hieß auch mal Linie 177) lagen. Diese Linie
durchquerte Lichterfelde West von Nord nach Süd. Auf
ihr waren unter anderem
TM 24/TM25 und später TM 33 in
Doppeltraktion im Einsatz. Aus einem dieser TW
stammt der von mir selbst entwendete Durchfahrtsplan
des Fahrers. Am Dahlemer Weg befand sich vor dem
Kriege auf der erweiterten Fläche zwischen der
Mörchinger Strasse und Unter den Eichen die
Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 40 und 77
welche auf den Unter den Eichen in Richtung Steglitz
und Innenstadt fuhren. Eine bis zum Schluss durch
Lichterfelde fahrende Linie war die Linie 96, welche
bis zum Mauerbau auch durch die Stadt Teltow fuhr. |

TM 24 |
|
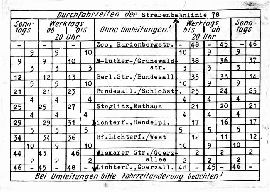 |

TM 36 mit Verbundsteuerung |
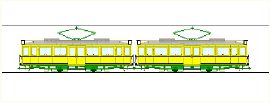
TM 33 Bj ab 1927 |
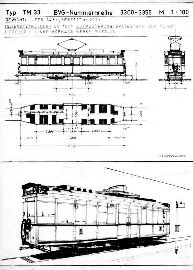 |
 Straßenbahn Linie 96
Straßenbahn Linie 96
|
|
Die Linie 96 durchquerte auf ihrer sehr
langen Strecke auch auch Lichterfelder Gebiet. Sie
war auf einem Teilstück aus der Teltower
Kreisbahnen
hervorgegangen. Anfangs wurde sie als
Dampfstrassenbahn betrieben Die Linie begleitete auf
fast der Hälfte ihrer Strecke in einem gewissen
Abstand den Teltowkanal bis nach Tempelhof.. Die
gesamte Linie 96 war eine der langen
Straßenbahnlinien Berlins. Sie entstand aus der
Zusammenlegung der Linie 100 (Machnow Schleuse - Bhf
Lichterfelde Ost) mit der Linie 96 (Behrenstrasse -
Lichterfelde Ost). Ein Teil dieser Strecke liegt ab
der Machnower Schleuse bis zur Stadtgrenze mit der
Groß-Berlin im Landkreis Teltow und verlief somit
nach 1945 auf Ostdeutschem Gebiet. Vor dem Krieg
fuhr die Linie 96 von Machnow Schleuse über die
Stadtgrenze von Berlin nach Lichterfelde Ost und
dann weiter über Lankwitz, Attilaplatz, Tempelhofer
Damm und den Mehringdamm sogar bis Berlin-Mitte zur
Behrenstraße, Ecke Markgrafenstraße. Nach dem
Krieg wurde die Strecke bis Mitte Oktober 1950
weiterhin durchgehend von der Westberliner BVG
betrieben. Ab Dezember 1950 entstand mit der
Abriegelung des Berliner Umlandes ein Inselbetrieb
von der Berliner Stadtgrenze bis zur Machnower
Schleuse (Diese ist die einzige Schleuse des
Teltowkanals). Der Inselbetrieb wurde mit dem
Mauerbau eingestellt. Ein dort aufgestellter
Triebwagen erinnert hier an diese Linie, die einmal
1905 als Dampfstraßenbahn AG angefangen hatte und
schon 2 Jahre später elektrifiziert wurde. Der
Westberliner Teil war eine der letzten 8 Linien, die
eingestellt wurden (2. Mai 1966). Sie führ zu dieser
Zeit vom Bahnhof Lichterfelde Ost bis zum U-Bhf
Mehringdamm und hatte ab Atillaplatz die
Streckenführung der Linie 95 übernommen. Das
Teilstück nach Mitte (Ost-Berlin) war schon lange
weggefallen. Zur
Machnower Schleuse gibt es weiter
unten beim elektrischen Treidelbetrieb weitere
Angaben. |
|

1905 steht noch
die Dampfstrassenbahn an der Schleuse |

Steht als Denkmal
an der Machnower Schleuse |
 |
 |
|

Blick in die
Schleuse |

Auf Westberliner
Seite wurden auch Doppeltriebwagen Br TM 36
eingesetzt |
 |

Fotos © 2011
Armin Meier und Laura Meier |
|
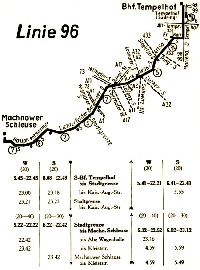
In den 50er
Jahren fuhr die 96 nur bis zum Bhf Tempelhof.
Fahrzeit knapp unter einer Stunde. |

Leider fehlt die
lange Stange zum Weichen stellen an der Front. Von
der Nummer her ein TM 36 aber ohne
Verbundsteuerung. |

Man darf sogar
hinein |

Der Fahrschalter |
|
Trotz aller
Stilllegungen im Westen hat Berlin immer noch das
drittgrößte Straßenbahnnetz der Welt
>>> 1990 - 125 Jahre Berliner
Straßenbahnen |
|
Ein weiterer
Betrieb der Teltower Kreisbahn war die
Straßenbahn
Adlershof–Altglienicke deren Strecke,
nachdem sie 1921 in die Berliner Straßenbahn
aufgegangen war, erst 1992/93 eingestellt wurde. |
 1882
Erster Oberleitungsbus der Welt
1882
Erster Oberleitungsbus der Welt |
|
Auf einer 540 m langen
Versuchsstrecke in Hallensee (heute Bezirk Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf) wurden durch
Siemens im Landkreis Teltow die ersten Versuche
mit einem Oberleitungsbus unternommen. Weitere
Unternehmen erprobten dann immer wieder im Landkreis
an verschiedenen Stellen mit wechselndem Erfolg ihre
O-Bussysteme. |
|

1882 - Erster
Oberleitungsbus der Welt von Siemens |
%20(01).jpg)
1904-05 -
O-Bus Niederschöneweide -Johannisthal (AEG-Stoll
Gleislose Strb ) Die Busse waren für die
Pflasterstrassen ungeeignet und hatten zu schwache
Motoren. |
.jpg)
1912-14 -
O-Bus Steglitz (Daimler-Stoll Gleislobus ).
Eigentlich wollte die Gmd. Steglitz eine eigene
Straßenbahn, aber der zuständige Kreis Teltow lehnte
dieses ab. |
.jpg)
1899 -
O-Bus Berlin Siemens Strassenbahn-Omnibus |
|
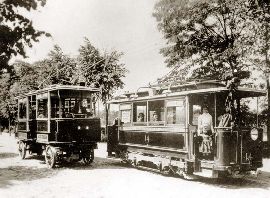
Dieser Schiemann
O-Bus von 1902 konnte unter den Fahrdrähten wenden
ohne die Stromabnehmerstangen umzuhängen. Daneben
ein Straßenbahnwagen (1000 mm) der Teltower
Kreisbahnen |
Nach
diesen Versuchsbetrieben fuhren in Berlin längere
Zeit keine O-Busse mehr. Erst in den 30er Jahren
wurden in Spandau und Steglitz wieder durch die BVG
O-Buslinien eingerichtet. Als Hersteller für die
Busse zeichneten Siemens, AEG, BBC und
Bergmann verantwortlich. Im Krieg auch Alfa und nach
dem Krieg waren es in West-Berlin Gaubschat / AEG
und in Ost-Berlin LOWA und Skoda. Die Nach dem Krieg
in Westberlin betriebenen O-Busstrecken hatten eine
Länge von ca. 31 km. Die Ost-Berliner Strecken
wurden erst nach dem Krieg ab 1951 eingerichtet. Auf
ihnen war sogar ein Doppelstock-Sattelschlepper-Bus
unterwegs. Der letzte im Raum Berlin
verbliebene O-Busbetrieb befindet sich - nach der
Einstellung des Berliner und des Potsdamer
(Babelsberger) Betriebes - heute in Eberswalde im
Norden von Berlin. Dort finden auch immer wieder
Fahrten mit den alten O-Bussen der BVG statt. Die
O-Busfahrer und Schaffner wurden auch scherzhaft als
Seilbahnfahrer bezeichnet und die Busse auch als
Drahtbusse. Die folgenden O-Busse waren auf Berliner
Strecken unterwegs. Nach 91 Jahren endete der
O-Busbetrieb in Berlin.
© 2011
Farbfotos dieser O-Busse Bernd Röhlke
|
|

Diese O-Bustypen
fuhren unter anderem auf der Linie A32 und A33 in
Steglitz
© 2011 Foto
Bernd Röhlke |
_1973_MiNr_447.jpg)
Auch wenn A 31
Spandau-West drauf steht, dieser Bustyp fuhrauch in
Steglitz auf der Linie A32 Diese Linie wurde
1965 als letzte Westberliner O-Buslinie
eingestellt. |

Auch in
Ost-Berlin waren nach dem Krieg 1951 wieder O-Busse
unterwegs, sogar Sattelschlepper-Doppeldecker
gab es. Ab 1956 wurden 2 weitere Linien
eingerichtet. |

Lowa O-Bus Linie
A40 - Zum Jahreswechsel 1972/73 wird auch in
Ostberlin der Obusbetrieb eingestellt
© 2011 Foto
Bernd Röhlke |
|
In
allen Berliner Straßenbahnen und Autobussen hingen
früher diese Linientafeln zur Fahrgastinformation.
Die Linien A31, A32 und A33 waren Westberliner
O-Buslinien. Sie hatten früher andere
Linienbezeichnungen. So war der A33 aus der
Meterspurstraßenbahn Linie M (Mariechen = für
Mariendorf) der Teltower Kreisbahnen, der späteren
Linie 97 hervorgegangen. Sie wurde dann lange als
Buslinie 97 betrieben. Der Betriebshof der beiden
letzten Strecken befand sich in Steglitz am
Hindenburgdamm. Die Linie A31 verkehrte in Spandau
und besaß dort eine eigene Wagenhalle. |
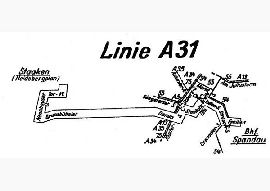
Da in Staaken die
Linie A31 genau auf der Sektorengrenze verlief wurde
dort später ihre Linienführung geändert |
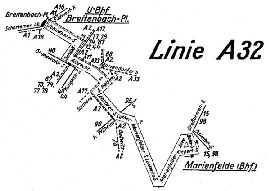
Die Linie A32 war
die längste O-Buslinie |
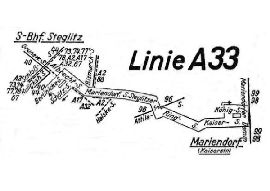
Die Linie A33
ersetzte die Meterspur Straßenbahnlinie 97 und lief
eine Zeitlang auch unter dieser Linienbezeichnung |
|

Nachkriegsbus von
Gaubschat |

© 2011 Foto
Bernd Röhlke |
 |
 |
|
Das Fahrgeräusch
dieser Busse habe ich noch heute in den Ohren. Sie
fuhren durch unsere Strasse.als A 33 |
 1900-1902 Wannseebahn /
1903-1929 Anhalter Vorortbahn -
Elektrischer S-Bahn Probebetrieb (Gleichstrom)
1900-1902 Wannseebahn /
1903-1929 Anhalter Vorortbahn -
Elektrischer S-Bahn Probebetrieb (Gleichstrom) |
|

Bhf.
Lichterfelder-Ost |
Mit
Gleichstrombetrieb hatte man auch schon früher bei
der ersten Straßenbahn in Lichterfelde Erfahrungen
gesammelt. Nun wurde zwischen 1900 und 1902 auf der
Wannseebahn von der Firma Siemens einen
Probebetrieb mit 750 V Gleichstrom durchgeführt.
Hierfür wurde die Strecke bis Zehlendorf mit
Stromschienen ausgerüstet. Die hier gewonnenen
Erkenntnisse wurden von der UEG (AEG)
bei der Anhalter Vorortbahn genutzt, die ab
1903 gleichfalls mit Stromschienen bis Lichterfelde
Ost mit 550 V Gleichstrom betrieben wurde. Dieser
Betrieb wurde erst im Jahre 1929 auf das heutige
System mit 800 V umgestellt. Er ist auf Grund seiner
Dauer eigentlich der Anfang des elektrischem
S-Bahnbetriebs in Berlin. Beide Strecken hatten
ihren Anfang am Potsdamer Bahnhof. Verwendet wurden
für den Betrieb die in großer Anzahl vorhandenen
preußische Abteilwagen, von denen ein paar Exemplare
für diese Versuche umgebaut wurden. Man wollte diese
Wagen als zwischen die Zugfahrzeuge kurzgekuppelte
Beiwagen auch in Zukunft weiter verwenden können und
nur durch einige vor- und nachgespannte
Triebfahrzeuge ergänzen. In dieser Richtung gab es
auch Versuche mit Wechselstromantrieben. Diese
fanden als Großversuch in Hamburg und in Schlesien
sowie in Mitteldeutschland auf der Strecke
Dessau-Bitterfeld statt. Für Berlin fiel dann die
Entscheidung mit Gleichstrom zu fahren. |
|
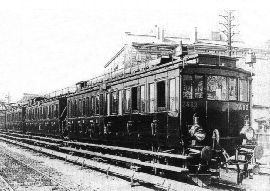
S-Bahn
Versuchsbetrieb durch Siemens auf der Wannseebahn
von 1900 -1902 |

Lage der beiden
S-Bahn Versuchsbetriebe - Grün = Wannseebahn /
Rot = Anhalter Bahn |
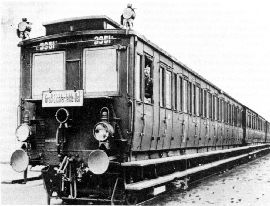
Anhalter Bahn
S-Bahn Versuchsbetrieb der UEG von 1903 - 1929 |

Ehm. AEG
U-Bahnwagen auf der Anhalter Bahn
Zur Geschichte
und Restauration des

 |
|

 Als U-Bahnwagen 1915 geplant und 1916 gebaut -
Als S-Bahn Vorläufer von 1921 bis 1929 im Einsatz
Als U-Bahnwagen 1915 geplant und 1916 gebaut -
Als S-Bahn Vorläufer von 1921 bis 1929 im Einsatz |
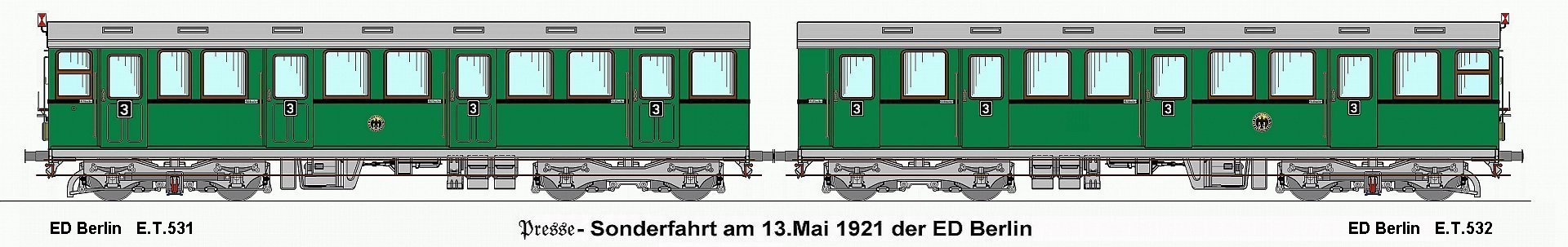 |
|
Auf einem
Anschlussgleis des noch teilweise vorhandenen
Gleisnetzes der Teltower Kreisbahn wird zur Zeit der
E.T.531
vom Münchener Dipl. Ing. Wolfgang Kämmerer
restauriert. Er will diesen wieder Betriebsfähig
herrichten.
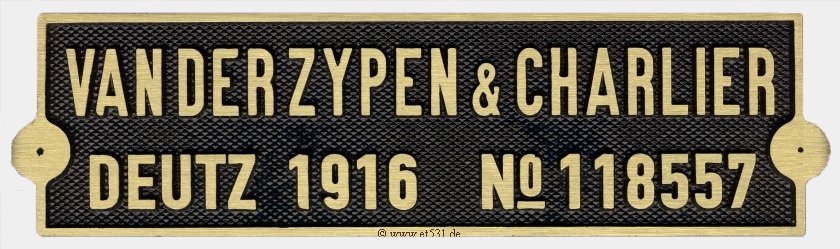
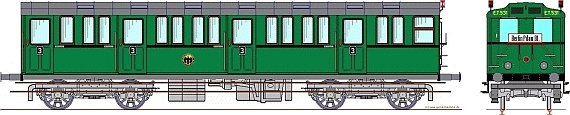 |

Anhalter Bahn
- S-Bahn Versuchsbetrieb der UEG (AEG) von
1903 bis 1929 vom Potsdamer Bahnhof bis Lichterfelde
Ost. Zwischen die Triebwagen wurden kurz gekuppelten
3-achsige Abteilwagen - so genannte Leitungswagen -
eingefügt. 18 Stück dieser Abteilwagen waren
vorhanden. Diese erste elektrische Vorortlinie (eine
Vollbahn) wurde mit 30 dieser Triebwagen
betrieben. In Spitzenzeiten wurde im 5 Min Takt
gefahren. |
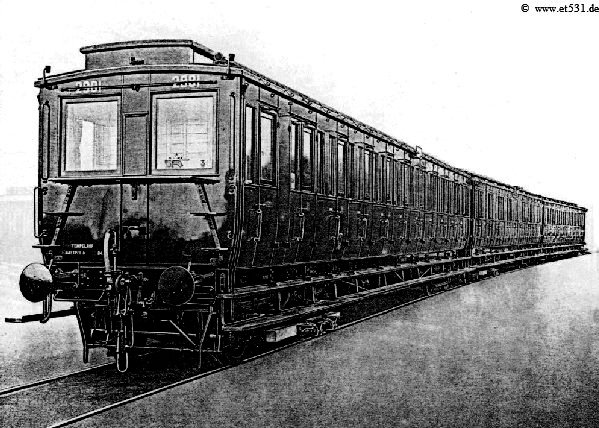
Der ET 531
wurde dem Publikum im Jahr 1921 als Fahrzeug der 2.
Generation präsentiert. Er war jedoch ein Prototyp
der AEG U-Bahn (A.E.G.-Schnellbahn A.G - G/N-Bahn).
Er wurde auf Grund seiner Technik zum Urahn der
Berliner S-Bahn. Er besaß als erstes S-Bahnfahrzeug
sich selbst schließenden Schiebetüren. Im gleichen
Jahr wurde auch die Elektrifizierung der
Vorortstrecken mit 800 V Gleichstrom beschlossen. |
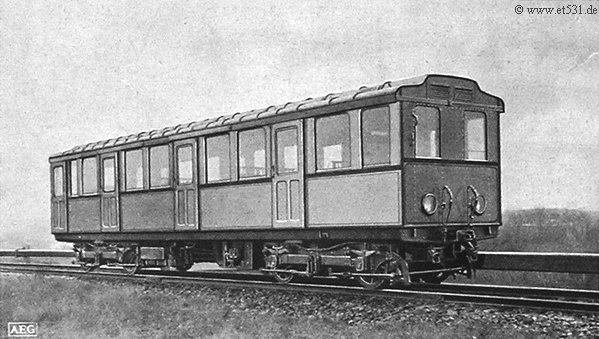
ET 531
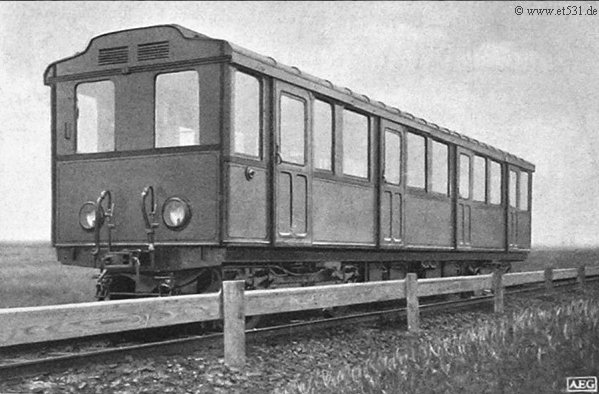
|
|
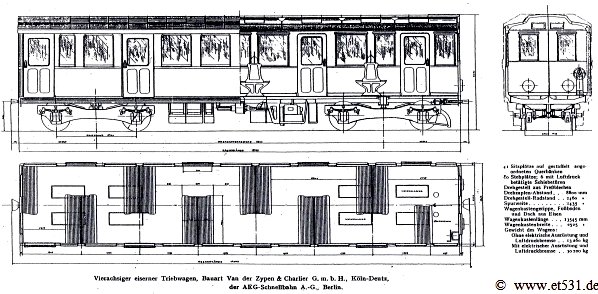
Die ungewöhnliche
Sitzplatzanordnung |

Herr Kämmerer mit
seinem SKL |
 |
 |
|
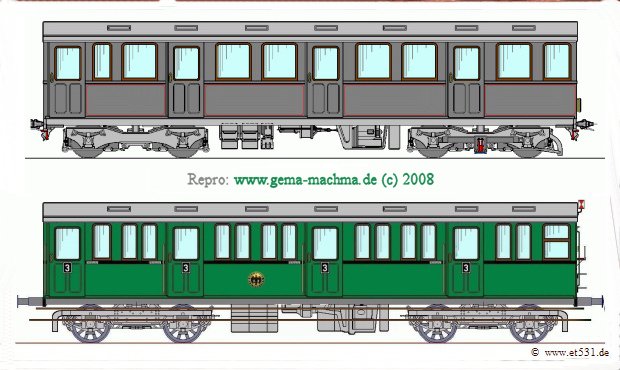 |
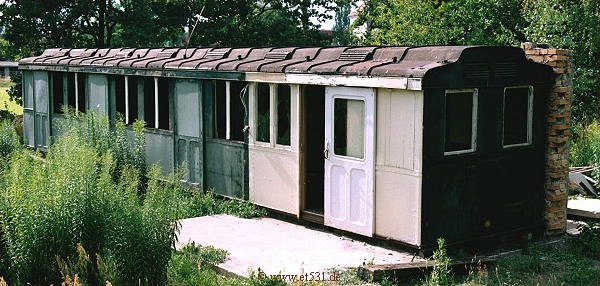
So wurde der
Wagen in Elstal vorgefunden |
 |

Beginnende
Restauration in Teltow |
|

In Grau als
U-Bahn, in Grün als S-Bahn |

Restaurierte
Frontansicht |
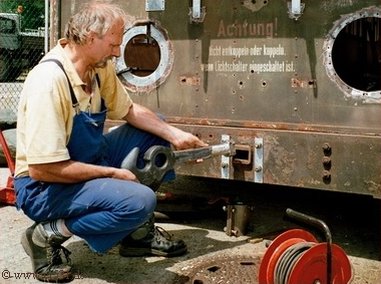
Einbau des neuen
Zughakens
|

Die neuen
Scheinwerfer
|
|

 |
 |
 |

Ein neues
Fahrgestell von der U-Bahn |
 1906
Elektrischer Treidelbetrieb am Teltowkanal
(Gleichstrom)
1906
Elektrischer Treidelbetrieb am Teltowkanal
(Gleichstrom) |
|
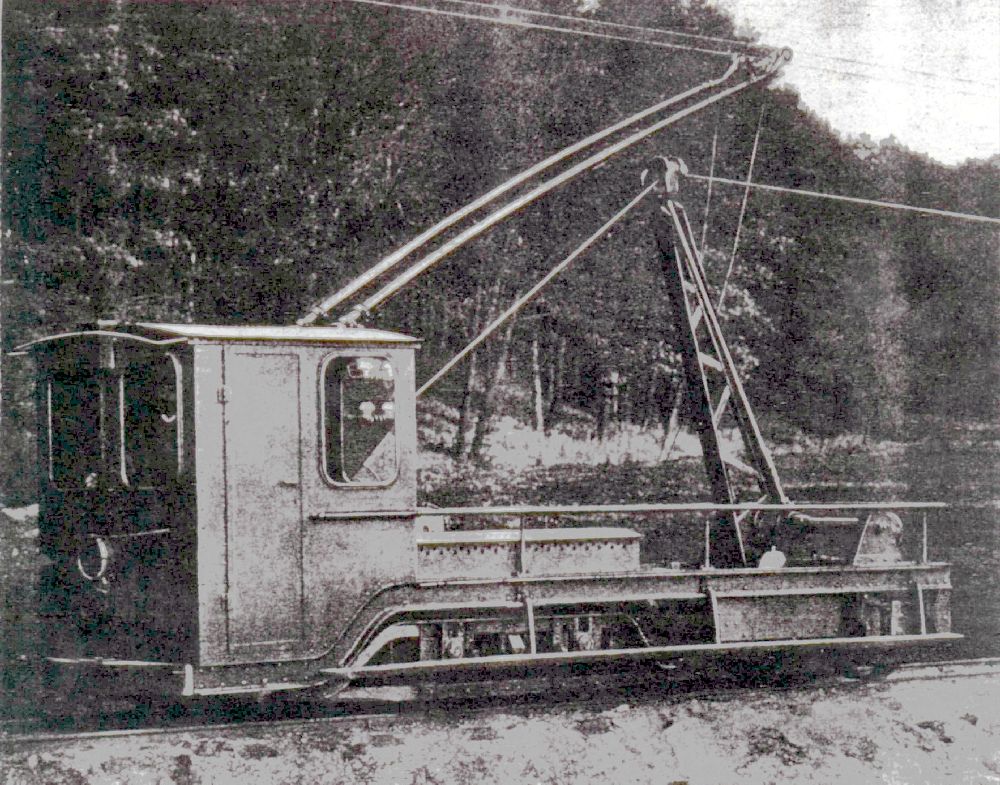
Es gab einen
Testbetrieb am Finowkanal bei Eberswalde. Ob dieser
auch dort mit dieser Lok erfolgte ist mir nicht
bekannt. Die Lok des Versuchsbetriebes mit
Stangenstromabnehmern ist in einem Bericht über den
Betrieb am Teltowkanal abgebildet und es soll auch
dort ein Testbetrieb stattgefunden haben. |
Eine weitere Bahn
mit Gleichstrom war die Treidelbahn des
Teltowkanals. Der Kanal führte unmittelbar durch
Lchterfelde und teilte die Gemeinde in zwei Hälften.
das Depot der Bahn war zwar nicht auf Lichterfelder
Gebiet, aber die Teltowwerft und das Kraftwerk lag
in unmittelbarer Nähe zum Gut Schönow, von dem noch
bei der Görzbahn die Rede sein wird. Auch ein
elektrischer Schleppdampfer mit Oberleitungsbetrieb
wurde vor der Machnower Schleuse erprobte Es
wurde beim Probebetrieb der Strom wie bei einem
O-Bus über zwei Stromabnehmerstangen zugeführt,
nachdem sich diese nicht bewährt hatten, wurde der
Strom durch einen auf den Oberleitungen laufender
Stromabnehmerwagen zugeführt. Die Kilometrierung des
Kanals erfolgt in unüblicher Weise gegen die
Fließrichtung von der Mündung aus. Anfangs war nur
ein Abwasserkanal geplant. Der Landrates des Kreises
Teltow, Ernst von Stubenrauch setzte sich jedoch für
den Bau einer Wasserstrasse ein, die eine
Wegverkürzung beim Verkehr zwischen Elbe und Oder
von ca.16 km ermöglichte und als Wasserstrasse neue
Industrie- und Wohnungsansiedlungen vor den Toren
Berlins ermöglichen sollte, sowie gleichzeitig als
Vorfluter den Regenwasserabfluss der Südlichen
Berliner Vororte aufnehmen konnte. |
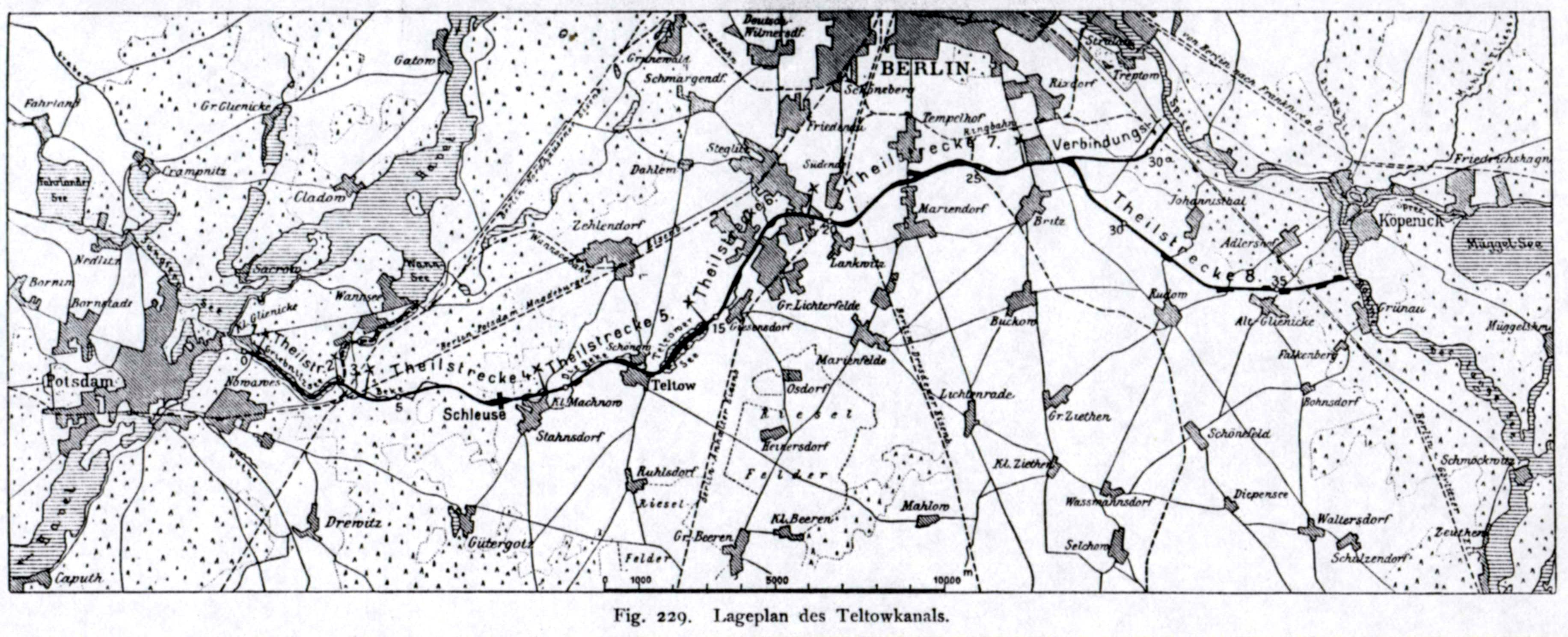
 |
|
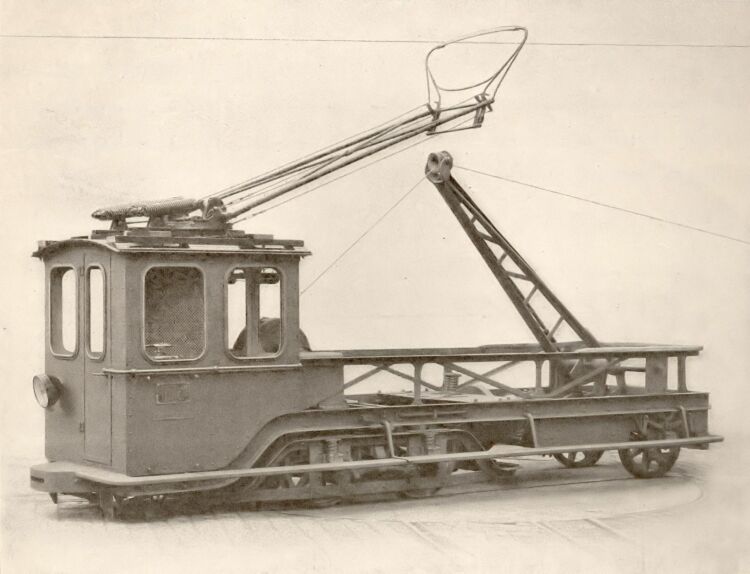
Elektrische
Treidellok des Teltowkanals in der endgültigen
Ausführung mit Bügelstromabnehmer. |

Denkmallok in
Lichterfelde- eine weitere Lok steht im Deutschen
Technikmuseum Berlin |
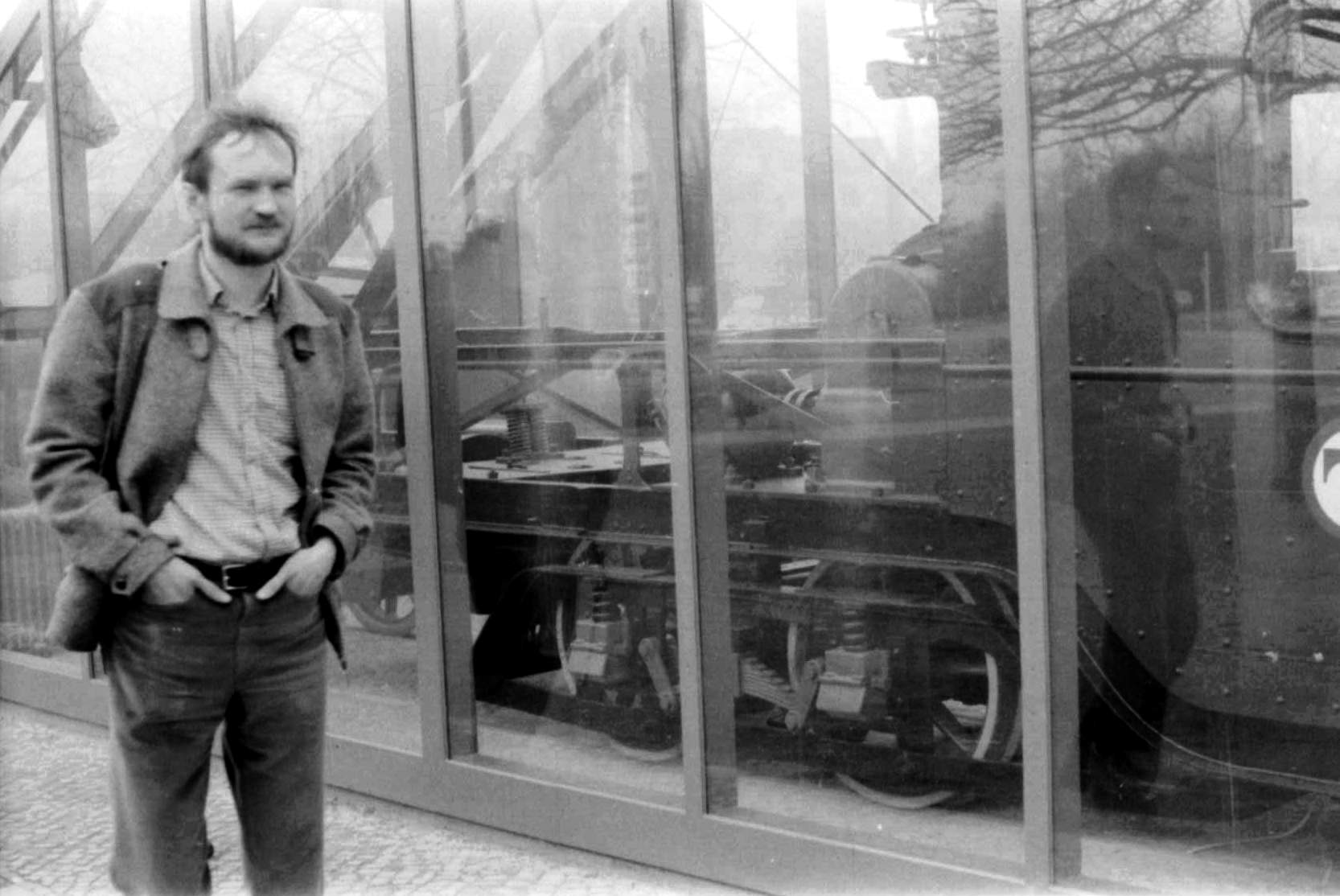
Vor der
Einhausung
© 2011 Fotos
Winfried Meier |

Lok beim treideln |

Die
 Machnower Schleuse
ist die einzige Schleuse des Kanal. Ihr
gesamter Betrieb erfolgt ohne Strom mit
Hotoppschen Hebern.
Die Schleuse ist als Sparschleuse ausgebildet und
überbrückt 2,74 m Höhenunterschied. Aus dieser
Differenz des Wasserstandes wird Über- und
Unterdruck zum Betrieb der Schleusentore gewonnen.
Eine Funktionserklärung
Machnower Schleuse
ist die einzige Schleuse des Kanal. Ihr
gesamter Betrieb erfolgt ohne Strom mit
Hotoppschen Hebern.
Die Schleuse ist als Sparschleuse ausgebildet und
überbrückt 2,74 m Höhenunterschied. Aus dieser
Differenz des Wasserstandes wird Über- und
Unterdruck zum Betrieb der Schleusentore gewonnen.
Eine Funktionserklärung |
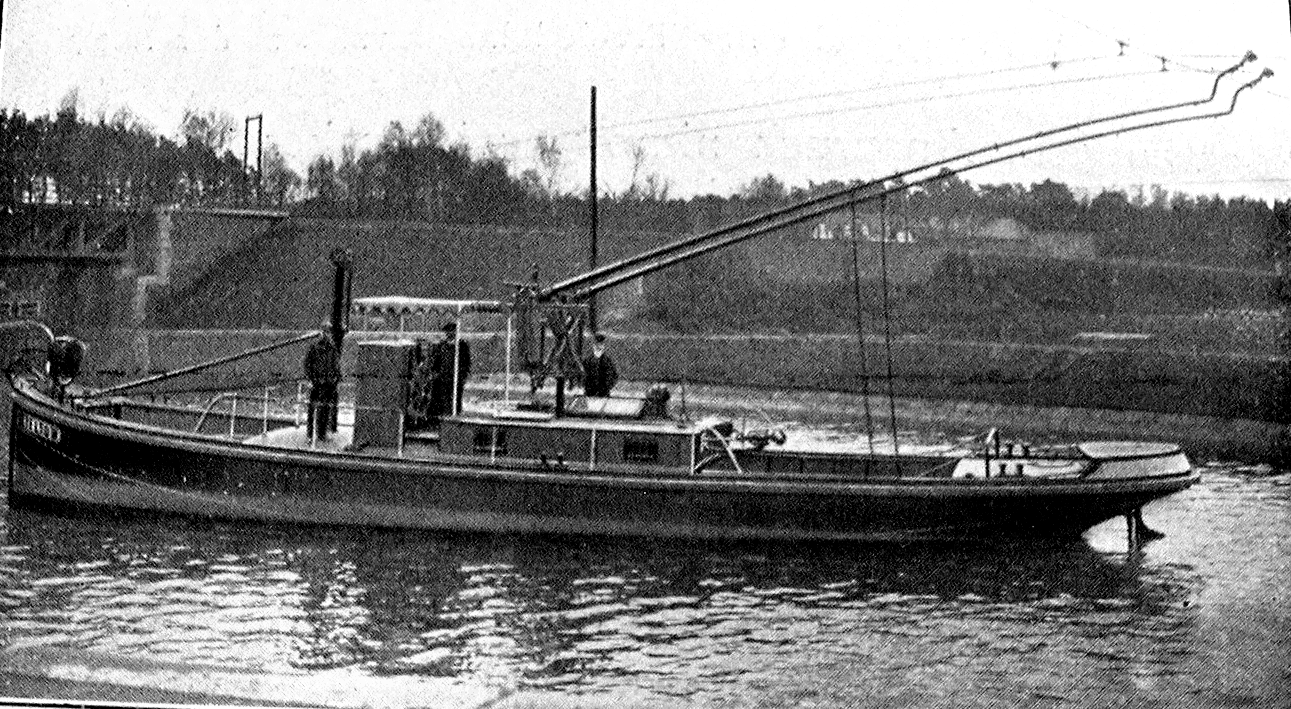
Der
Elektroschlepper Teltow
mit Stangenstromabnehmern
Der Schlepper
wurde Notwendig, da das moorastige Ufer des
Machnower See die Anlage einer Treidelbahn zu
vertretbaren Kosten nicht zuließ. Später wurde der
Schleppbetrieb durch den See mit Dampfschleppern
vorgenommen Um 1930 wurde dieser Betrieb wurde durch
ein von einer Motorwinde angetriebenes Endlosseil
ersetzt. |

Treideln mit
1 Lokomotive
Die Spurweite der
Treidelbahn betrug 1000 mm , die Loks wurden mit 550
V Gleichstrom betrieben und entwickelten eine
Zugkraft von 1,2 to. Die Schleppgeschwindigkeit
betrug 4 km/h. Es wurden 20 Lokomotiven geliefert
die nur in einer Richtung schleppen konnten. Für den
Britzer Seitenkanal, der nur ein nördliches
Treidelgleis besaß, wurden 2 Lokomotiven angeschafft
die auf dem Gleis in beide Richtungen ziehen
konnten. Die Höchstgeschwindigkeit ohne Last betrug
13 km/h. |
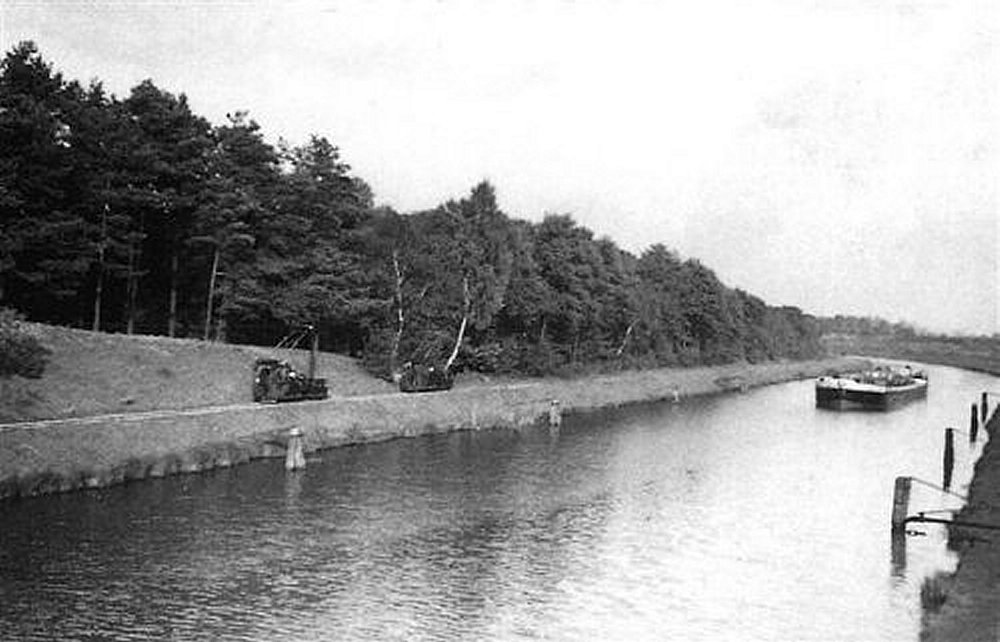 Treideln mit 2 Lokomotiven
Treideln mit 2 Lokomotiven
1932 wurden 4
weitere Lokomotiven der ersten Bauart mit einer
höheren Schleppleistung von 1,6 to gekauft. Sie
konnten mit einer Geschwindigkeit von 5,5 kn/h die
Schiffe ziehen. 1942 erfolgte nochmals eine
Lieferung von 2 weiteren Lokomotiven gleicher
Bauart. Weiteres unter dem Link:
Treidelbahn am Teltowkanal |
|
(Einen gewissen
Bezug zu Schleusen haben mein Bruder und ich, da ein
Onkel Oberschleusenmeister der
Mindener Schachtschleuse
war und wir dort öfters in die 13 m tiefe
Schleusenkammer geschaut haben) |
|

Die Teltow-Werft
|

Auf dem Gelände
der Werft befand sich auch der Bauhof des
Landkreises und das Kraftwerk und die Werkstatt der
Treidelbahn. |
Die
Teltow-Werft
leistete technische Pionierarbeit im elektrischen
Lichtbogen-Schweißen und baute 1927 mit dem
Fahrgastschiff Zehlendorf
der Teltower Kreisschiffahrt das erste komplett
geschweißte Schiff in Deutschland.
|

Das Tor zum Depot
mit dem Logo der Bahn |

Der Teltowkanal
am Hafen Lankwitz um 1965 mit dem GASAG
Gaswerk Mariendorf
im Hintergrund von der Sieversbrücke bei km 20,47
aus fotografiert |

Das GASAG
Gaswerk Mariendorf war zeitweilig das größte
Gaswerk Europas |

Blick mit einem
Teleobjektiv auf das Gaswerk |
|

Gleiche Stelle
wie oben der Hafen Lankwitz
|

GASAG Hafen
Mariendorf mit Treidelbrücke um 1965 |

Im Winter. Man
sieht hier auch die Überladestationen der
Förderbänder |
Liste der Brücken über den Teltowkanal |
|

Dieses war mal
eine Treidelbrücke. Sie wurde zur Fußgängerbrücke
umgebaut und an anderer Stelle in Lankwitz als
Ersatz für eine im Krieg zerstörte Straßenbrücke
eingebaut. |


Nun ohne Kräne
und ohne Treidelbrücke |

Der Hafen wird -
obwohl eigentlich nun ohne Funktion - noch immer
betriebsbereit gehalten Derhinter befindet dich nun
das Zentrallager der Kaisers Tengelmann AG |
.JPG)
Teubertbrücke
(Foto aus Wikipedia) Die Brücke wurde nach ihrer
Zerstörung im II.WK 1948 durch die Firma Dellschau
gehoben und wieder instand gesetzt. |
|
Nach
dem Bau des Teltowkanals entstanden im Landkreis
Teltow zu beiden Seiten des Kanals an mehren Stellen
Industriegebiete. So in Teltow, in Lichterfelde, am
Hafen Steglitz, am Hafen Lankwitz (erst ein Kohle- später
ein Mineralöllager), das Gaswerk Mariendorf und ein großes
Industriegebiet in
Tempelhof. Dieses erstreckt sich ab dem
Tempelhofer Damm
(Hafen Tempelhof)
bis zu Grenze mit Britz/Neukölln (Rixdorf).
Man sprach zeitweilig vom Stahlbaudreieck
Tempelhof, da sich am Teltowkanal mehre große
Stahlbaufirmen und Stahlhändler niedergelassen
hatten (Dellschau/Ravené, Steffens und Nölle AG,
Krupp-Druckenmüller). Aber auch andere bekannte
Firmen bauten hier ihre Fabriken auf. Darunter
waren
C.
Lorenz
AG (SEL), die
Vereinigten Berliner
Kohlenhändler (VAUBEKA), die
Sarotti AG,
Ullstein, die
Dreusicke GmbH, das
Post- und Telegrafen- Zeugamt, die
Holzmann AG, später
auch Phillips und schon auf Britzer Gebiet
J. D. Riedel (Riedel-de Haën
AG), Ph.Mühsam und das
Efha-Werk (PDF S.12).
Auch entlang der Ringbahn siedelten sich viele
Industrieunternehmen an wie z.B.
Gillette (Otto Roth,
Specialfabrik für Rasier-Apparate;Gillette
Roth-Büchner GmbH), Elektrolux, die
Chemische Fabrik Tempelhof,
die
Ufa mit einem Filmgelände
(und
Carl Froehlich mit
zwei Glashäusern auf gleichem Gelände) , ein
Hüttenwerk (Hüttenwerke A. Meyer) und auch die Firma
Freudenstein (ging in O&K auf) nahmen hier ihren
Anfang. Viele der Firmen befinden sich in
Industriekomplexen mit sehenswerten Gebäuden der
Industriearchitektur der Gründerzeit und frühen
Moderne.
Bruno Buch
erstellte hier sehenswerte Gebäude. Der
Teltowkanal und die Bahnen waren die Nabelschnüre
dieser Fabriken. Ein weiteres Industriegebiet
abseits vom Kanal befindet sich an der Alboin und
Bessemer Strasse. Formal gehört das Gebiet zu
Schöneberg, ist aber von dort durch die zwischen dem
Ortsteil und dem Industriegebiet liegende Eisenbahn
kaum zu erreichen. Es befindet sich dort das
"Opelwerk Berlin" der Adam Opel AG, die
Isophon-Lautsprecherwerke,
die
Schultheiss-Mälzerei (Schultheiss-Patzenhofer
Brauerei AG), die Brotfabrik von
Schlüterbrot-Bärenbrot, die
Parfümeriefabrik Schwarzkopf
und auch
Magirus (seit 1913)
und auch Maggi war mal dort ansässig. Auch die
anschließend besprochene DEAG hatte dort einen
großen Lagerplatz. Im Norden wird das Gebiet durch
die Reichsbahn Hauptwerkstätten Tempelhof und wieder
durch die Ringbahn begrenzt. Dort befindet sich auch
der riesige Bau des
ehemaligen
Reichspostzentralamtes (Geburtsort des
Fernsehens) in der Ringbahnstrasse. Ein weiteres
großes Industriegebiet entstand an der Dresdener
Bahn in Marienfelde. Hier waren es vor allem
Daimler-Benz (zuvor
Fahrzeugfabrik Altmann & Cie / Motorfahrzeug- und
Motorenfabrik Berlin AG (MMB)), die
Fritz Werner Werke
und Siemens die hier Fabriken errichteten und
zeitweilig wollte sich auch Ford hier ansiedeln
(Ford Damm) |
|
 U-Bootbau am
Teltowkanal in Berlin-Tempelhof (Firma Dellschau
Stahlbau)
U-Bootbau am
Teltowkanal in Berlin-Tempelhof (Firma Dellschau
Stahlbau) |
|
Der
Teltowkanal besaß nur eine Schleuse in Machnow. Dort
fanden im davor liegendem Machnower See die Versuche
mit dem Elektroschlepper statt. Die sehenswerte
Schleuse steht heute unter Denkmalschutz Sie war als
Doppelkammerschleuse für Finow-Maßkähnen geplant und
als eine der wenigen Schleusen in Deutschland mit
Hotoppschen Hebern ausgestattet worden. Sie war also
eine Sparschleuse. 1939 kam eine 3. Kammer für 1000
t Schiffe hinzu. Hintergrund war das aus Tempelhof
Druckkörper für U-Boote
(Sektion II für den
Typ XXI) an die
norddeutschen Werften geliefert werden sollten.
Lieferant war die 1821 gegründete Berliner
Eisenhoch- und Brückenbau Firma G. E. Dellschau. Deren
Muttergesellschaft die Deutsche
Eisenhandel AG, Berlin-Charlottenburg unterhielt
in dieser Zeit auf dem Gelände in Tempelhof ein Gemeinschaftslager für ausländische
Arbeiter bestehend aus drei Baracken für
Französische Zwangsarbeiter. Sie dürften dort für
den U-Bootbau eingesetzt worden sein.
Ein
ehemaliger Prokurist der alt eingesessenen Berliner
Eisenfirma G..E. Dellschau - Arthur Koppel (1851–1908)
- beteiligte sich mit 15 000 RM an der 1876 in
Schlachtensee bei Berlin gegründeten oHG „Orenstein
& Koppel“.
Benno Orenstein war
mit einem Darlehen eines Onkels von 3000
RM beteiligt. Aus dieser Firma entstand die größte
deutsche Feldbahnfabrik und eine der großen
deutschen Lokomotivfabriken.
Mein Großvater
war über 40 Jahre für Dellschau tätig Anfangs
als Betriebsleiter, dann rund 25 Jahre bis zu seinem
Tod 1958 als technischer Direktor und
Geschäftsführer dieser und weiterer Schwesterfirmen
vor Ort
(Dellschau, Ravené, Degner, Steike, TLG).
In wie weit die
neben der Firma
Dellschau liegenden Firmen
Steffens &
Nölle (diese Firma baute den Berliner
Funkturm) und
Krupp-Druckenmüller als Zulieferer
für die U-Boot Sektionen tätig waren, ist mir nicht
bekannt. Zumindest war mein Großvater im und nach
dem Krieg (für die Alliierten) auch in diesen
Firmen kommissarisch tätig und besaß z.B. einen
Werksausweis für Steffens & Nölle, eine
der bekanntesten Stahlbaufirmen für Türme und
Sendemaste, der ihn als
Direktor auswies. Sehr viele Stahlskelettgebäude,
Straßen- und Eisenbahnbrücken in Berlin und Umland
wurden durch die Firma Dellschau errichtet.
Dellschau war der Stahlbaubetrieb, Ravené die
Handelsfirma. Um 1947 waren ca..1300 Mitarbeiter
beschäftigt. Die Firmen wurden dort vor Ort bis in
die 60er Jahre praktisch in Personalunion betrieben.
Alle
diese Firmen gehörten zur Holding der Deutsche
Eisenhandels AG die von
Georg von Caro
aufgebaut worden war.
Die
Firma Dellschau wurde in den 60er Jahren aufgelöst
und das Baugeschäft an die Firma Krupp-Druckenmüller
abgegeben, Die Schwesterfirma Ravené besteht mit
ihrem Handelsgeschäft in Tempelhof weiter.
Auch heute noch befindet sich
die
Schwesterfirma Ravené am ehemaligen Standort der Firma Dellschau im
Industriegebiet Tempelhof-Ost.
Auch die U-Boothalle ist noch vorhanden. |
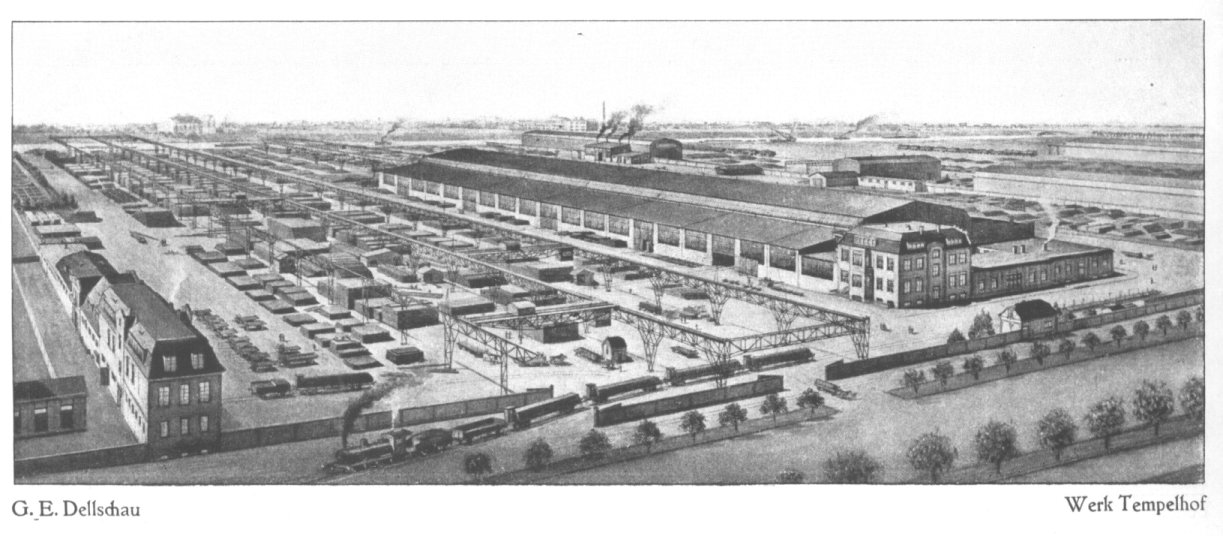
Über einen Teil
der Doppelkranbahn wurde später die U-Boothalle
gebaut |
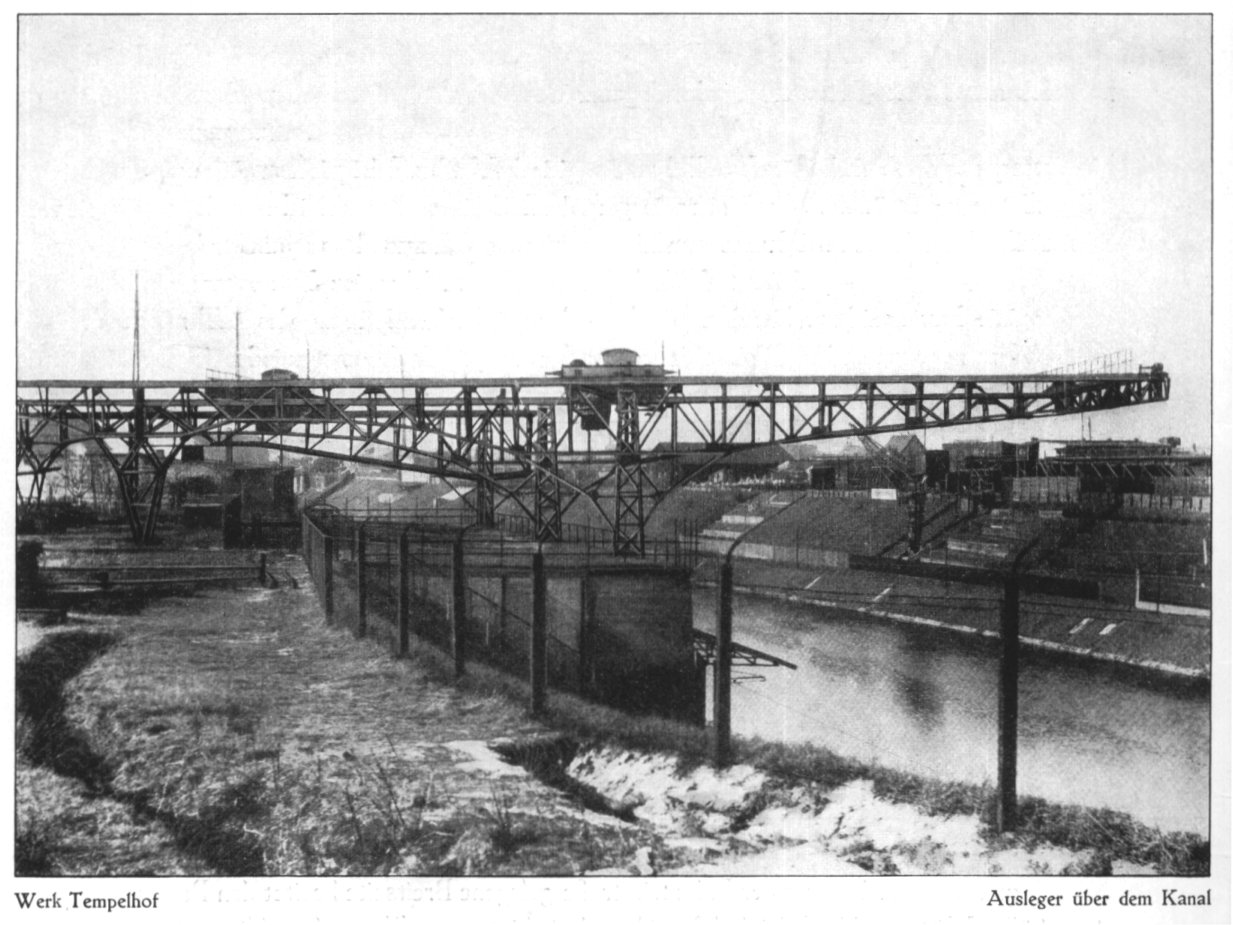 |
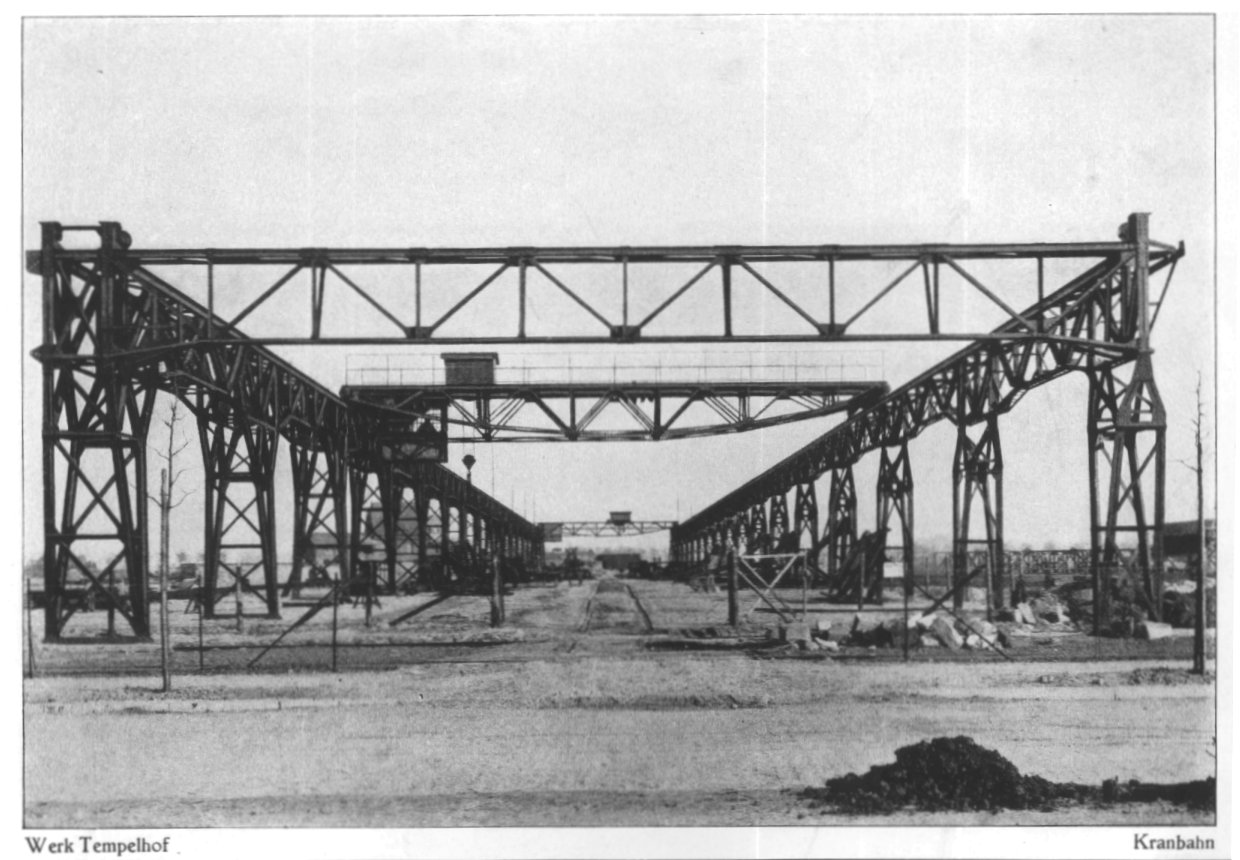 |
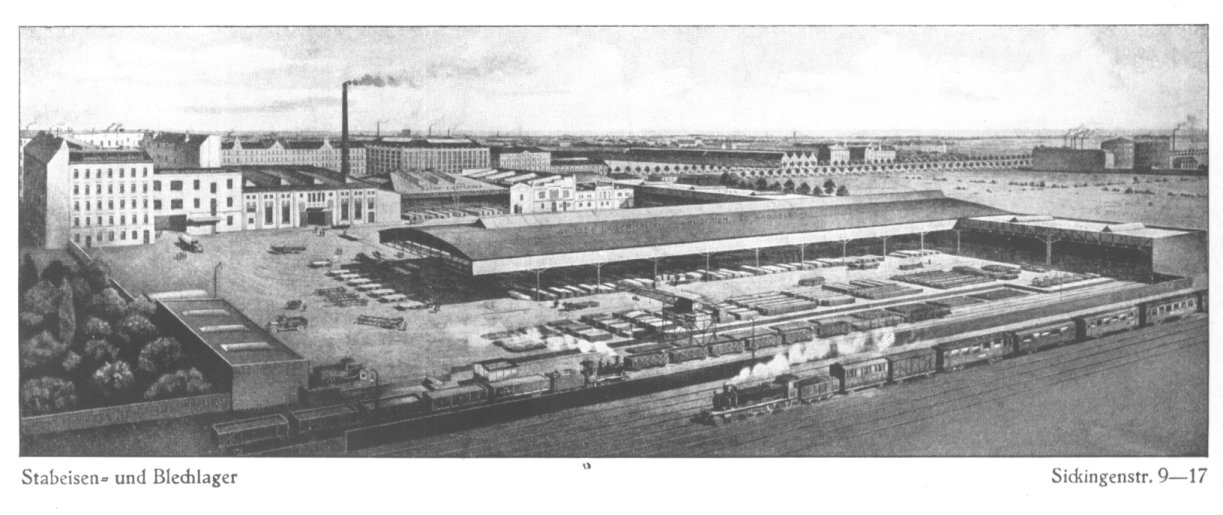 |
Die Kranschienen
sind inzwischen durch blau gestrichene Vollträger
ersetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals
befindet sich Raab-Karcher und die Firma Sarotti |
Das untere
Verwaltungsgebäude hat längst einen Zwillingsbau mit
einem zusätzlichen Mittelteil erhalten |
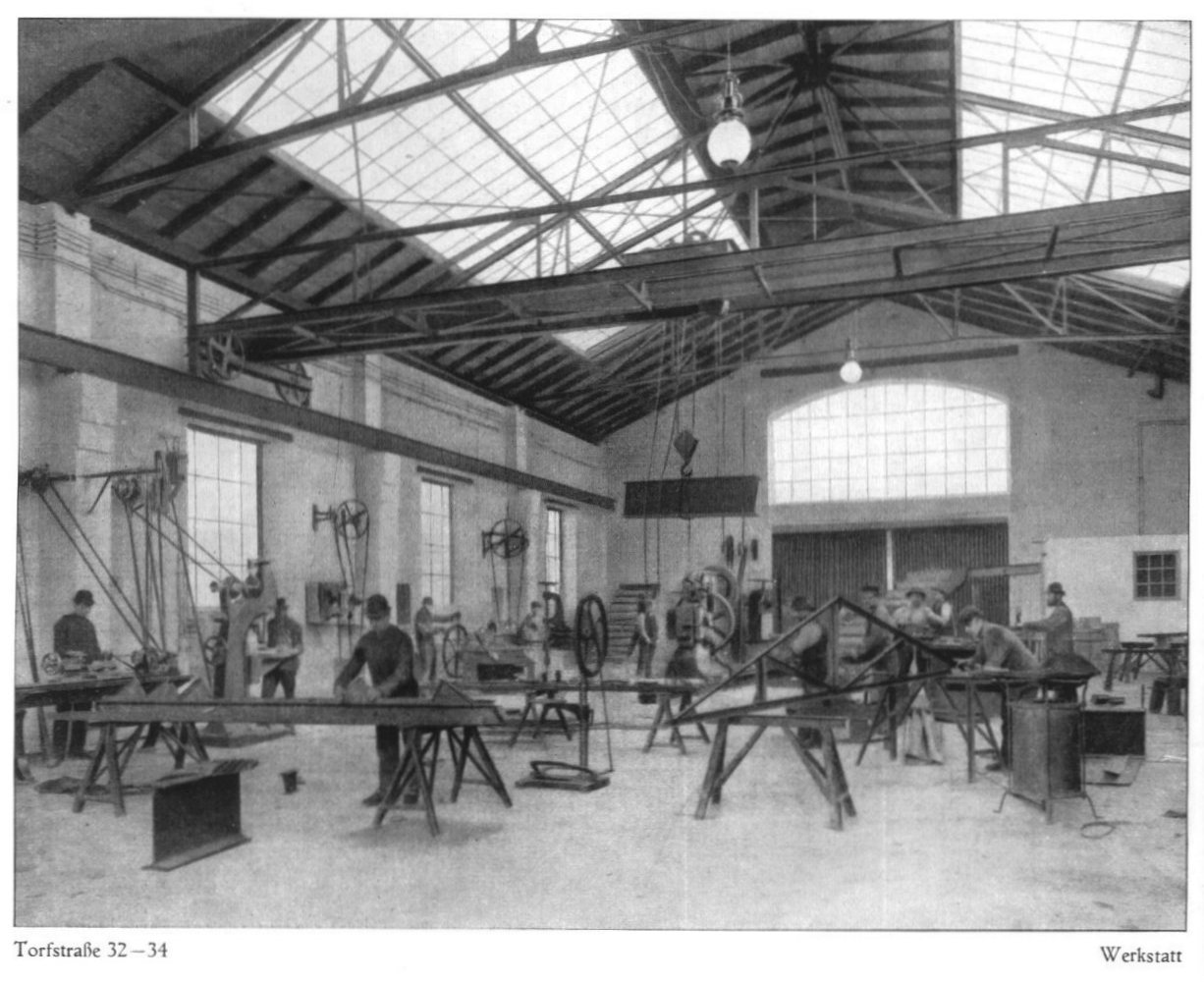 |
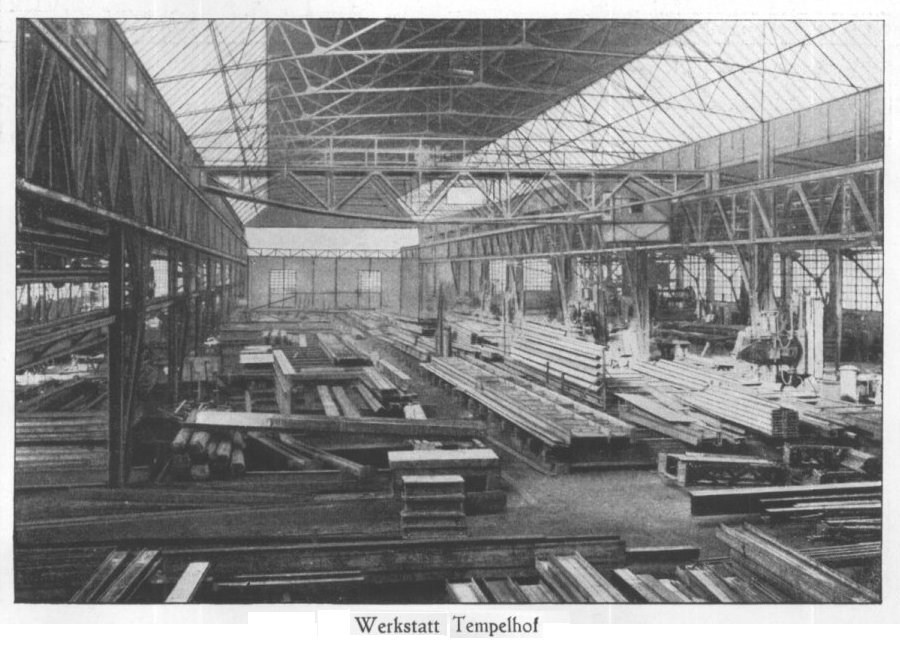 |
 |
|
Die alten Bilder stammen
aus einer Festschrift zum 100jährigem Bestehen der
Firma Dellschau im Jahr 1921. |
|
An gleicher Stelle
befandet sich nach dem Krieg auch die Deutsche
Eisenhandels AG. Die seit dem 1.1.1910
bestehende DEAG war unter anderem aus der erst 1906 gegründeten Vereinigten
Ravené'schen Stabeisen- und Trägerhandlungen AG
hervorgegangen. Vor 1945 war sie eine der bedeutendsten
Handelsgesellschaften im Metallbereich mit einem
sehr umfangreichen Beteiligungsbestand von
über 80 Beteiligungen im Jahr 1943 (meist
Handelsfirmen, Eisen- und Eisenwaren-Handlungen,
deren älteste bereits 1776 gegründet wurde). Die
DEAG war der größte konzernunabhängiger Eisen- und
Stahlhändler in Deutschland. Sie war bis vor kurzem
eine börsennotierte Holding-AG im Eigentum der
Possehl-Stiftung.
Der Großaktionär ist die L. Possehl & Co. GmbH in Lübeck mit
seinerzeits 99,87%, der
Rest war Streubesitz mit 0,13%. In ihr waren
die die Stahlhandelsaktivitäten der
Possehl-Gruppe zusammengefasst. Der Umsatz
betrug um die 260 Mil. €. Inzwischen wurden der
Streubesitz ausgezahlt und das Handelsgeschäft der
DEAG an die ArcelorMittal-Gruppe verkauft.
Die DEAG ist heute nur noch eine leere Hülle im
Besitz der Possehl-Gruppe. In Tempelhof am ehem.
Sitz der Firma Dellschau und Ravené befindet
sich nun an
gleicher Stelle die
ArcelorMittal Stahlhandel GmbH, Niederlassung
Ravené, Berlin und wirbt damit, dass sie auf
fast 300 Jahre Geschichte in Berlin zurückblicken
kann und seit 1921 am Standort Tempelhof für ihre
Kunden vertreten ist.
|

Werbematerial der
Firmen Dellschau
& Ravené
aus den 40er und 50er Jahre |

 |
|
Siehe zu Ravené in
 Wikipedia:
Wikipedia: |
|
Ravené (Firma Jac. Ravené & Söhne), |
|
Francois David
Ravené († 1748) |
|
Pierre Ravené
(* 1723 – † 1798) |
|
Jacques Ravené (* 1751 in Berlin; † 1828 in
Berlin) - Söhne Karl Peter (1777 – † 1841) und
|
|
Pierre Louis
Ravené (* 10. Februar 1793 in Berlin; † 31.
Dezember 1861 in Berlin),
|
|
Louis Fréderic Jacques Ravené (* 1. Juni 1823
in Stettin; † 28. Mai 1879 Marienbad),
Schwager von
Adolph von Hansemann |
|
Reichsburg Cochem |
|
Louis
Ferdinand Auguste Ravené (* 13. Dezember 1866
in Berlin; † 20. Januar 1944 in Berlin) |
|
Pierre Louis
Ravené (* 1891 - † 03.04.1945 in
Berlin) |
|
Theodor Fontane verwertete sehr viele
Episoden aus dem Umfeld der Familie Ravené als
Vorlagen in seinen Romanen. Fontanes Ehefrau war die
Freundin der Ehefrau von Paul Harder, dem
Prokuristen der Firma Ravené. |
|
Über
die 1775 gegründete Schwesterfirma Ravené, ihren
Gründer und seine Nachfolger gibt es einige
Literatur, leider jedoch nicht über die Firma
Dellschau. Aus diesem Grunde werde ich die
Festschrift zum 100 jährigen Bestehen der Firma G.E.
Dellschau im Jahr 1921 und ein Handbuch von 1921 auf
einem separaten Server hier ins Netz stellen. Wie
auch Ravené war die 1821 gegründete Firma Dellschau
erheblich an der Entwicklung des Stahlbaus in Berlin
beteiligt. Inzwischen hat
Robert Dellschau die
Festschrift in einer unwesentlich
gekürzten modernen Fassung ins Netz gestellt. Ich
werde das Original trotzdem nachreichen, da es mehr
Bilder enthält. |
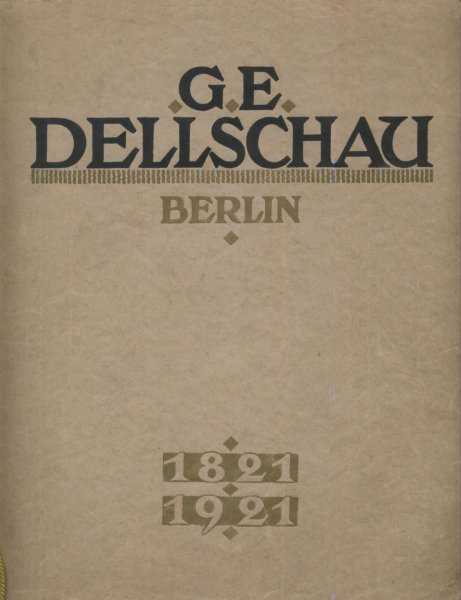 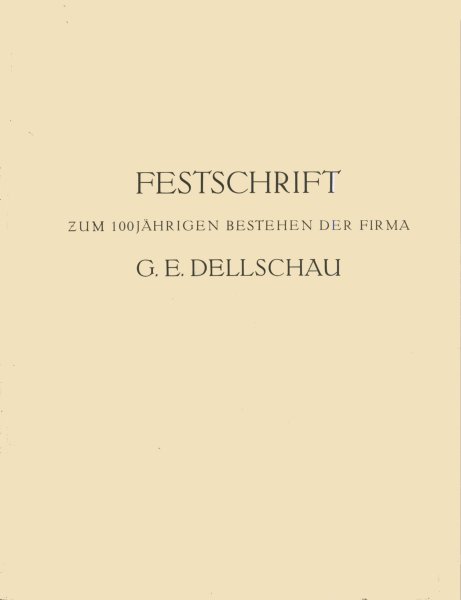 |
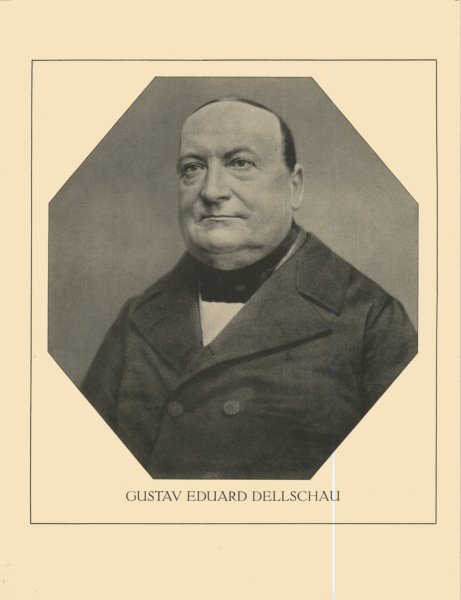 |
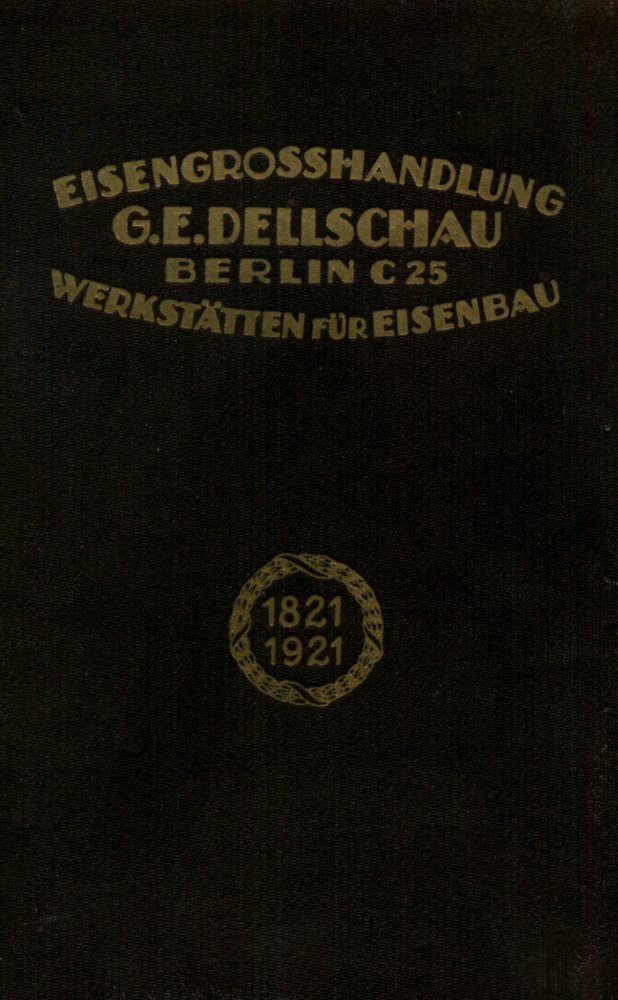 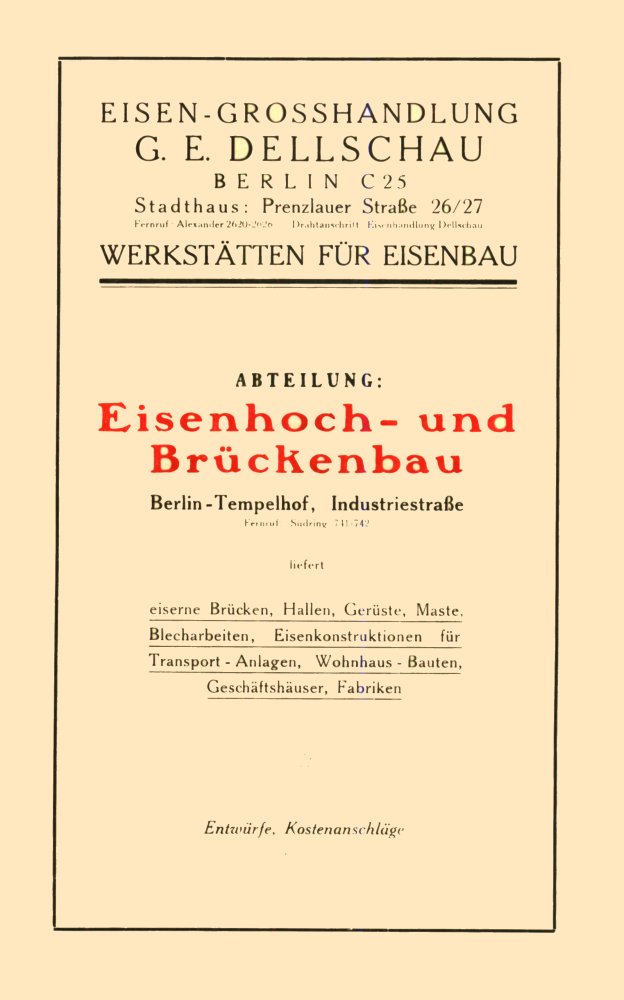 |
 1900 Erste Versuche mit Drehstrom
1900 Erste Versuche mit Drehstrom |
|
1900 fanden in Lichterfelde-West
entlang der Goerz Allee
die ersten Versuche mit Drehstrom als
Antrieb statt. |
|
.jpg) |
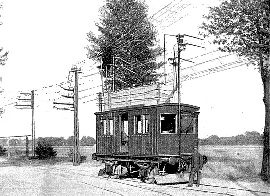 |
.jpg) |
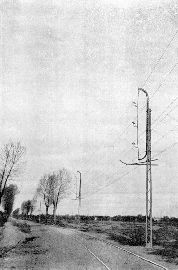 |
|
 1903 Schnellfahrversuche auf
der Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen mit
Drehstrom
1903 Schnellfahrversuche auf
der Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen mit
Drehstrom |
|
Die Drehstromversuche wurden später auf
der
Militäreisenbahn Marienfelde - Zossen (liegt
auch im Landkreis Teltow) fortgesetzt
und führten 1903 zu Schnellfahrversuchen mit einem
Weltrekord von über 200 km/h auf der Militärbahn.
Die dort erprobte Güterzuglokomotive wurde halbiert und eine Hälfte landete mit
Wechselstromausrüstung bei der LAG auf der Strecke
Murnau-Oberammergau. Sie erhielt bei der Reichsbahn
1934 einen neuen Aufbau und war später noch bei der DB
im Einsatz. Die andere Hälfte wurde bei Siemens
in Berlin-Siemensstadt als Werklokomotive verwendet. |
|
.JPG)
Diese
Lok fuhr über 150 km/h schnell |

Die eine Hälfte als
Werklokomotive in Siemensstadt
© 2011 Foto Bernd Röhlke |

Die andere Hälfte bei
der DB. Sie hat seit 1934 einen neuen Aufbau
© 2011 Foto Bernd Röhlke |
.jpg)
Der Fahrdraht |
|
.jpg)
S&H
stellte am 23.10.1903 einen Weltrekord mit einer
Geschwindigkeit von 206,7 km/h auf. dieser hatte nur
4 Tage bestand. |
.jpg) |
.JPG) |
.jpg)
Siemens
& Halske Triebwagen |
|
.JPG) |
Die
AEG
fuhr dann Weltrekord am 27.10.1903 mit 210,3
km/h. Kein großer Unterschied, aber etwas
schneller Die erreichbaren Geschwindigkeiten waren
von der vom Kraftwerk gelieferten Frequenz und
Spannung abhängig. |
.JPG)
AEG
Triebwagen |
.JPG) |
|
Mit
den ersten Stromlinienlokomotiven der Welt wollte
man auf der gleichen Strecke den Weltrekord
für Dampfloks mit ausgeschriebenen 150 km/h brechen.
Dieser Rekord war 1903 mit einer bad. IId mit
144
km/h aufgestellt worden Da das 3 Zylindertriebwerk
der S9 nicht gut gelungen war, erreichte man
mit dem "Möbelwagen" am 1. und 2. Juli 1904
beim Rekordversuch nur 137 km/h und verfehlte das
Ziel nur knapp. Besonders interessant war an der Lok
der vorne liegende Führerstand. Man testete bei
dieser Gelegenheit eine ganz normale S 7 Bauart
Hannover und diese erreichte immerhin 143 km/h ohne
Verkleidung. |

Die
eine S9 von Henschel wurde im Lieferzustand mit
Teilverkleidung, die andere S 9 wurde mit einer
Vollverkleidung geliefert, die zu ihrem Spitznamen
"Möbelwagen" führte. |
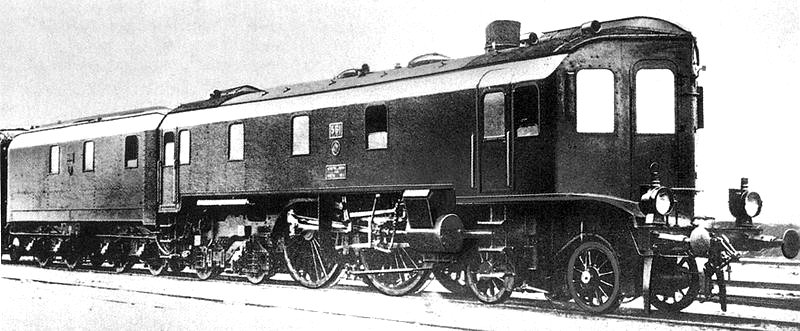
Der Möbelwagen
Später waren beide Loks ohne diese Verkleidung und
mit hinterem Führerstand bis 1918 im Einsatz.
|
|
 1903
-1906 Erster elektrischer Versuchsbetrieb der
Welt mit Einphasen-Wechselstrom
1903
-1906 Erster elektrischer Versuchsbetrieb der
Welt mit Einphasen-Wechselstrom |
|
Der
Versuchsbetrieb erfolgte südöstlich von Berlin
im Landkreis Teltow vom Bhf Schöneweide zum Bhf Spindlersfeld. Die Strecke ist eine Stichstrecke von der Bahnline
nach Görlitz (Schlesien) aus. Spindlersfeld gehört zu Köpenik und liegt auf der anderen Seite
der Dahme (Wendische Spree) näher an der Altstadt,
wie der eigentliche Bhf. Köpenik an der Bahnlinie
nach Frankfurt / Oder. |
|
.jpg)
Triebwagen 2051&
5052 mit 3-achsigen Zwischenwagen |
.jpg)
Triebwagen des
Versuchsbetriebes |
Die
beiden Triebwagen der waren eigentlich für den
Drehstrombetrieb der Lokalbahn
Murnau-Kohlgrub-Oderammergau (L.M.K.O.) gebaut
worden. Wegen Konkurses der Bahn kam es nicht zum
Einsatz. Um den im Versuchsfeld gut funktionierenden
Winter-Eichberg-Motor im Bahnbetrieb zu erproben,
nutzte die UEG (AEG) die zwei vorhandenen Wagen und baute
sie für diesen Zweck um. Der Versuchsbetrieb nach Spindlersfeld verlief erfolgreich. Haute wird die
Strecke von der S-Bahn befahren. Ab 1906 kamen die
Triebwagen dann auf der Kreisstrecke der Oranienburger
Versuchsbahn im Norden von Berlin zum Einsatz. |
|
Weitere
Eisenbahnen im Landkreis |
 Neukölln-Mittenwalder
Eisenbahn (NME)
Neukölln-Mittenwalder
Eisenbahn (NME)
  |
|
Technisch
innovativ war die NME nie, aber irgend wie doch
für die weitere Entwicklung Berlins und der
Industrie im Süden von Berlin von grosser Bedeutung,
denn sie erschloss den nordöstlichen Landkreis
Teltow (dem späteren südöstlichen Raum südlich
Berlins). Zur Erschließung des Industriegebiets
Tempelhof-Ost mit Fabriken wie Sarotti oder Standard
Elektrik Lorenz (SEL) führte ein Nebengleis parallel
zum Teltowkanal entlang der Teilestraße und
Ordensmeisterstraße bis zum Hafen Tempelhof sowie
auf der anderen Seite des Kanals vom
Güterbahnhof Teltowkanal (seit 1907
Betriebsmittelpunkt der NME) aus entlang der
Industriestrasse, und Volkmar Str. fast bis zum
Druckhaus Ullstein. Hier befanden sich große
Stahlbaufirmen und das Zentrale Post- und Telegrafen
Zeugamt. Ostlich des Gbhf. Teltowkkanal befanden sich weitere
Fabriken, die von der NME bedient wurden wie z.B. Krupp-Druckenmüller
und Riedel de Haen. Anfangs war die Bahn jedoch
gebaut worden um in den Gründerjahren vor allem Ziegelsteine aus Mittenwalde
und dem Schöneicher Plan nach Berlin für den
Aufbau der neuen Hauptstadt zu Transportieren.
Später wurde überwiegend Müll zur Verfüllung der
Lehmgruben in die Gegenrichtung gefahren. In den
30er Jahren wurde in Schönefeld ein Anschluss an
die Henschelwerke und deren Bahn hergestellt.
Während der Blockade wurde auch ein Anschluss an den
Flughafen Tempelhof gebaut. Die Königs Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)
erreicht in Konkurrenz zur NME gleichfalls
Mittenwalde von Königs Wusterhausen aus. Ab 1920 lag
die Betriebsführung beider Bahnen bei der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Vering &
Waechter GmbH & Co. KG Berlin. Nach der Teilung
Berlins verblieb nur noch der im Westberliner Gebiet
liegende Teil in ihrer Betriebsführung. Ab 1980
übernahm die ihnen gehörende Bahn diese dann selber.
Im Süden der verbliebenen Reststrecke würde das
Kraftwerk Rudow und die Eternit-Werke bedient. Vom
Bahnhof Buckow (hier war anfangs der
Betriebsmittelpunkt der Bahn) gab es einmal vor dem Krieg eine
Feldbahn in die Grube bei Groß Ziethen (lag nach dem
Krieg im Osten). Nach der Wiedervereinigung wurde
mit der NME auf einem neu errichtetem Gleis sehr
viel Aushub vom Potsdamer Platz dorthin befördert
und bescherte ihr gewaltige
Transportleistungen.
© 2011 Fotos
Bernd Röhlke |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Auch das gab es
bei der NME
Radarfalle im Gleisbett
Und plötzlich hat’s nicht
„blitz“, sondern „bums“ gemacht ... Von wegen
stillgelegte Strecke, |
 |

Rechts das
Anschlussgleis der NME an den Flughafen Tempelhof |

Blick auf den
Flughafen Tempelhof |
 Königs
Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)
Königs
Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn AG (KMTE)
  |
|
Diese Bahn ist heute als
Draisinenstrecke in Betrieb. |
Motzenseebahn (K.M.T.) |
|
 Teltower
Eisenbahn
Teltower
Eisenbahn
  |
|
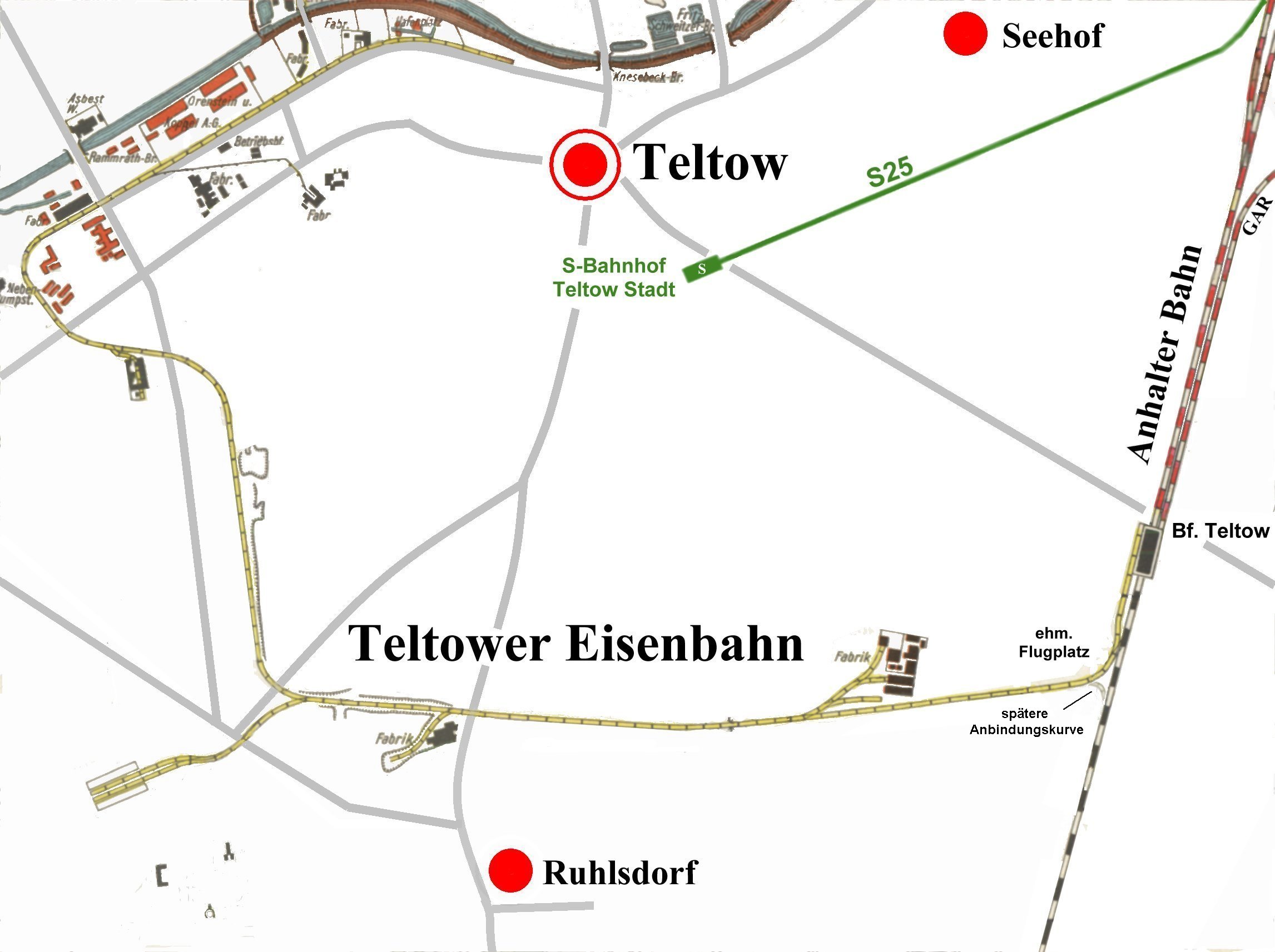
Die Situation
um1960 mit Lage der neuen S-Bahn |
Die Teltower
Eisenbahn führte vom Staatsbahnhof Teltow an der
Anhalter Bahn im großen Bogen enzlang der Ortsgrenze zum Hafen Teltow.(Ruhlsdorf
wurde erst später eingemeindet). Ihre länge betrug
knapp 8 km. Teltow lag in der Mitte zwischen zwei
Staatsbahnlinien und der ab 1900 gebaute Kanal
trennte Teltow vom benachbarten Vorort Schönow.
Dieser orientierte sich nach Norden und Teltow nach
Südosten zu den jeweiligen Bahnlinien,. Da sich entlang
des Teltowkanals auf beiden Seiten des Kanals Industrie
ansiedelte, benötigte diese die Gleisanschlüsse. So lag
z.B. die Firma O&K mit einem Betrieb am Kanal
(heute ist dort ein Baumarkt) auf
Teltower Seite. Die Teltower Eisenbahn war sozusagen
das Gegenstück zur
Zeulhag (Görzbahn) auf der
anderen Seite des Teltow-Kanals. Auch diese verband
auf der anderen Seite des Kanals
Industriebetriebe am Teltowkanal mit der weiter
entfernt liegenden Hauptbahn. Sie wird später separat beschrieben.
Der Betrieb auf der Bahn endete in zwei Etappen 1994
und 1998. Anfangs erfolgte die Anbindung der Bahn an
die Hauptstrecke in Richtung Bhf. Teltow, später mit
einer Kurve in entgegen gesetzter Richtung. |
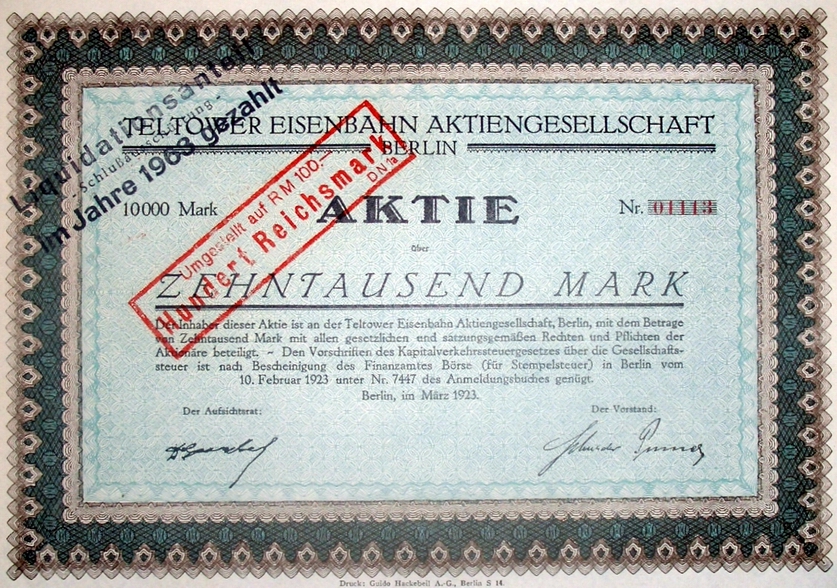 |
 Die
Friedhofsbahn - Die S-Bahn nach Stahnsdorf (Stahnsdorfer Bahn)
Die
Friedhofsbahn - Die S-Bahn nach Stahnsdorf (Stahnsdorfer Bahn)
  siehe auch:
Bahnstrecken im Süden Berlins siehe auch:
Bahnstrecken im Süden Berlins |
|
Fotos werden nach
Sichtung nachgereicht |
|
|
|
 Feldbahnen und Werksbahnen
Feldbahnen und Werksbahnen |
|
Feldbahnen gab es
im Landkreis im Verlauf der Jahrzehnte viele. Nur
einige fest installierte Feldbahnen können hier
erwähnt werden. Die anderen haben wenig Spuren
hinterlassen. Sie wurden z.B. beim Bau des
Teltowkanals eingesetzt. Nach dem Krieg als
Trümmerbahnen und im Tiefbau für Erdbewegungen.
Anfang der 60er Jahre beschloss der Berliner Senat
entlang des Teltowkanals einen durchgehenden
Grünstreifen als Erholungs- und Spazierweg
anzulegen. Hierfür wurden auch nochmals Feldbahnen
zum Einsatz gebracht. Wir sind selber auf den
Humushügeln herumgeklettert und haben am Wochenende
- sehr zum Ärger der Bauarbeiter - die Gleise
umgelegt und sind mit den Lorenuntergestellen die
Humushügel hinuntergerauscht. Die anschließend
beschriebenen Betriebe und ihre Bahnen stehen stellvertretend für alle
anderen hier nicht genannten Feldbahnen und
Werksbahnen. |
 Mülldeponie
Groß-Ziethen
Mülldeponie
Groß-Ziethen |
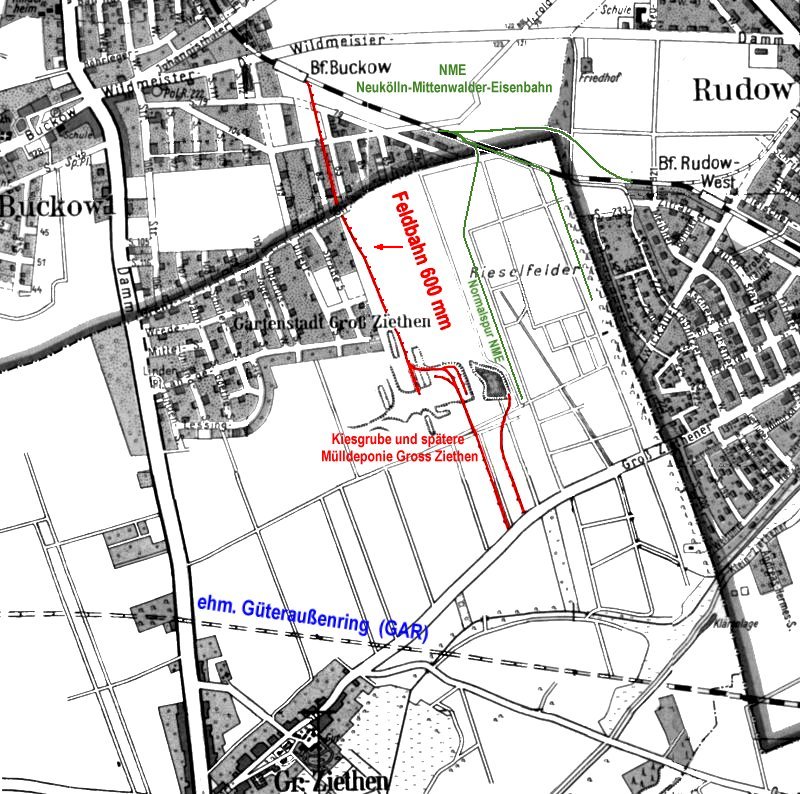
Leider besitze
ich keine Fotos der Bahn |
Zwischen der
Neukölln-Mittenwalder-Eisenbahn NME und dem
damaligen
Güteraußenring GAR
befand sich direkt neben der Gartenstadtsiedlung
Groß-Ziethen eine
große Kies-Grube. Von diese bestand eine 600 mm
Feldbahnverbindung zum Bhf Buckow derr NME.
Der Bhf. war mal der Betriebsmittelpunkt der NME. Ich bin in
West-Berlin Anfang der 60er Jahre als Jugendlicher
noch auf den Gleisen der Feldbahn vom Bhf Buckow bis
zur Grenze gelaufen. Dort war die Verbindung durch
die Grenze unterbrochen. Nach der Einstellung des
Kiesabbaues hatten sich im Laufe der Jahre in der
Grube Seen
gebildet Später wurde die Grube als
Mülldeponie genutzt. In den 60er Jahren zu DDR
Zeiten wurde dort Industriemüll in die Seen
verkippt. Auch Müll aus West-Berlin wurde von
1972 - 1977 über einen extra eingerichteten
Kontrollpunkt dort hin gefahren. Nun erhitzt die
Grube auch die Gemüter der Umweltschützer, da neben
und auf der Grube
Neubausiedlungen
geplant sind. Inzwischen gibt es zur Deponie
eine Gleisverbindung von der
NME aus in
Normalspur. Es wurde Aushub von Potsdamer Platz nach
hier befördert.
|
|
 Firma C. Lorenz AG
Firma C. Lorenz AG |
|
|
Auf dem Gelände
der
Firma C. Lorenz AG
in Berlin-Tempelhof war eine fest ausgebaute
Feldbahn im Einsatz. Im Jahr 1917 - dem Geburtsjahr
meines Vaters - bezog die Firma Ihren Firmensitz auf
der anderen Straßenseite der Ordensmeister Str., die
Familie meines Vaters wohnte - bis sie in den 30er
Jahren nach Lichterfelde West zog - genau gegen über
der Fabrik der Firma Lorenz. Mein Vater berichtete
mir später von dieser Bahn, die er als kleiner Junge
gesehen hatte. Was noch von ihr zu entdecken ist,
ist mir leider unbekannt, Ich habe an anderer Stelle
von ihrer Existenz gelesen und werde wenn ich mal
vor Ort bin nachforschen. Die Bahn diente in der
Firma Lorenz dem innerbetrieblichen Transport. |
|
 Gaswerk
Mariendorf
(GASAG)
Gaswerk
Mariendorf
(GASAG) |
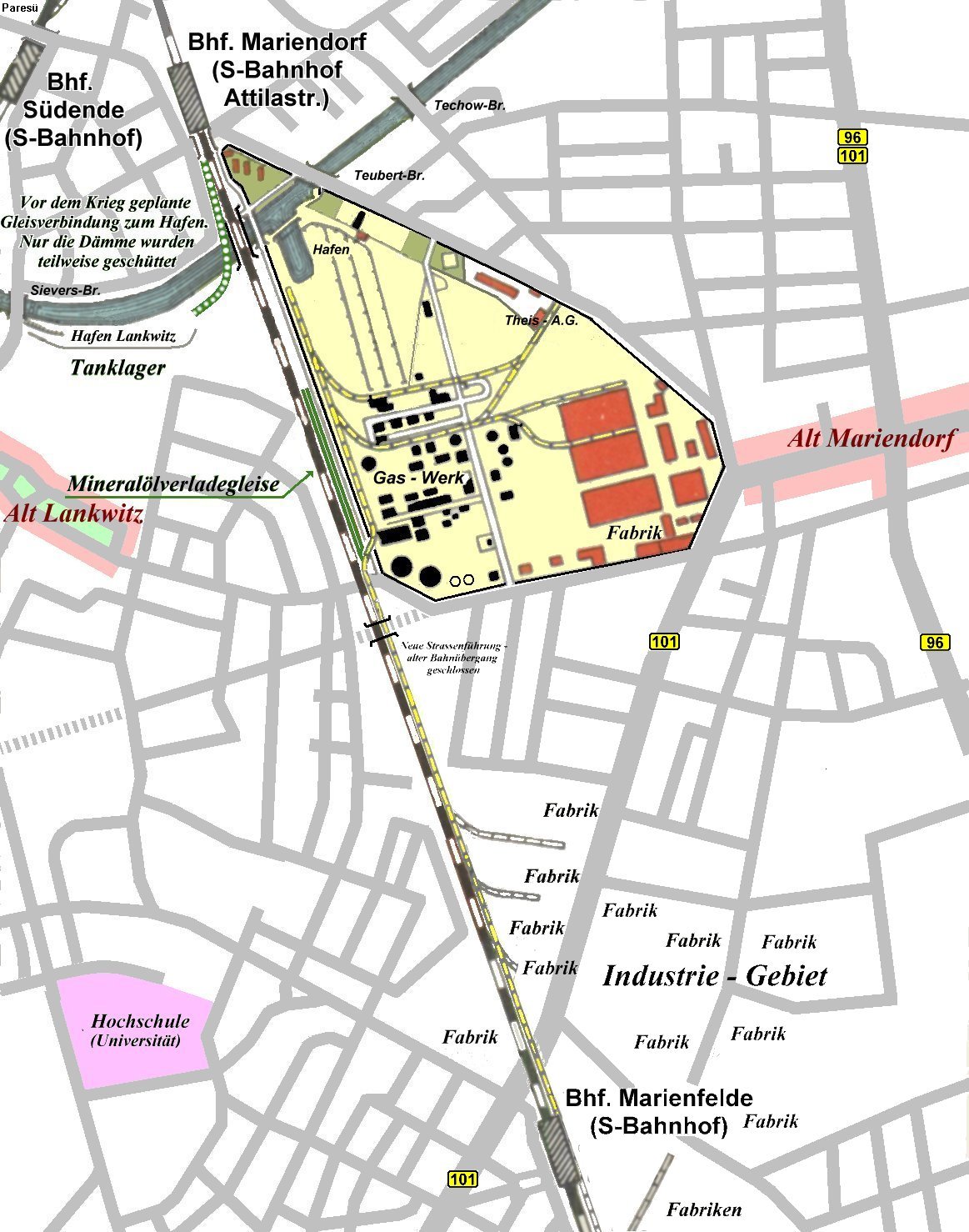
Stand:
Mitte der 60er Jahre mit einigen Neuerungen späterer
Jahre |
Das Gaswerk
Mariendorf war im Jahr 1902 auf einem über
780000 m² großen Gelände erbaut worden, nach dem die
Gaswerke Kreuzberg und Schöneberg ihre
Leistungsgrenzen erreicht hatten. Alle drei Gaswerke
waren von der britischen
Imperial Continental
Gas Association (I.C.G.A.) erbaut und betrieben
worden. Das Gaswerk erhielt einen eigenen
Werksbahnhof und wurde über ein eigenes
Streckengleis mit dem Bahnhof Marienfelde verbunden.
Im Bhf. Marienfelde existierte eine eigene
3-gleisige Abstellanlage , so dass ohne Rangieren
komplette Kohlenzug von und zum Werk befördert
werden konnten. Auf dem Betriebsgelände wurde
auf einer 600 mm Feldbahn mit Handloren der Koks zum
eigenen Hafen transportiert. 1915 und 1916 wurden 2
Feldbahnlokomotiven erworben und der Handbetrieb
eingestellt. Als Folge des Krieges mit England 1916
wurde die Gasgesellschaft ICGA liquidiert. 1918 erhielten
die Landkreise Teltow und Niederbarnim den Zuschlag
für die gesamte Liquidationsmasse. Vom Gaswerk
Mariendorf wurden Zehlendorf, Steglitz, Schöneberg,
Tempelhof, Neukölln und Orte im Teltow versorgt. Die Stadt Berlin,
die mit ihren Städtischen Gaswerken der größte
Gasversorger Europas war, ging leer aus. Mit der
Verabschiedung des Groß-Berlin Gesetzes änderte sich
dieses, die Stadt besaß nun Anteile an
den Gasgesellschaften der ehemaligen Randgebiete,
der Deutschen Gasgesellschaft AG für den Kreis
Teltow und der Gasgesellschaft Niederbarnim mbH.
1923 wurde die
Städtische Gaswerke AG (GASAG)
gegründet. Diese besaß nun 16 Gaswerke. Viele dieser
kleinen Gemeindegas werke wurden kurz nach der
Übernahme geschlossen. Erst im Jahr 1939 war die Stadt Berlin in
der Lage, dem Kreis Teltow alle Aktien der Deutschen
Gasgesellschaft AG abzukaufen. 1942 waren
86000
Gaslaternen in Betrieb (zur Zeit sind
es noch ca. 44.000 Gasleuchten) und 93 % der Haushalte
kochten mit Gas. Die Länge des Rohrnetzes betrug
rund 7000 km. Nach dem Krieg existierten im Ost-
und Westteil der Stadt getrennte Betriebe. Der
Ostteil stellte ab 1962 auf Erdgas um, abgeschlossen
war dieses jedoch erst 1990. Der Westteil stellte ab
1985 auf Erdgas um. Zuvor hatte man ab 1965
Benzinspaltanlagen in Betrieb genommen und immer
weniger Gas aus Kohle gewonnen. Bis 1996 waren alle
Gaswerke stillgelegt . Das Gaswerk Mariendorf war
das letzte Gaswerk das geschlossen wurde. |
.jpg)
 |
|
 |
Das Gaswerk
Mariendorf der GASAG war zeitweilig das größte
Gaswerk Europas. Das Gaswerk
besaßt eine eigene Eisenbahn, die bis zum Bhf.
Marienfelde führte. Es sollen - wie oben beschrieben
- auch 600 mm Schmalspurgleise vorhanden
gewesen sein. Entlang der Bahnanlagen im Werk
läuft außerhalb ein 900m langer Fußweg mit einem
Maschendrahtzaun zum Werksgelände hin. Als
kleine Jungen haben wir oft durch den Zaun geschaut,
aber nur Normalspurfahrzeuge gesehen. Durch diesen Zaun
ließen sich die Fahrzeuge schwer fotografieren.
Später tauchten die GASAG-Loks (eine T3, eine Speicherlok
und eine Diesellok) an anderer Stelle auf. Dort erst konnte
man sie dann besser fotografieren. Eine Feldbahn
ist nur in der Literatur erwähnt. Mir selber sind in
den 50er Jahren eine lange Hängebahn mit Hängeloren
bekannt, Diese Bahn Hatte offensichtlich die
Feldbahn ersetzt und wurde später durch Förderbänder
ersetzt und führte vom Hafen zu den Vorratsbunkern
und -halden. Heute befindet sich dort das
Zentrallager der Kaiser´s Tengelmann AG. Diese Bahn
machte einen höllischen Lärm und die Kräne störten
gewaltig im Radio auf Mittelwelle. Auf dem östlich
angrenzenden Gelände neben dem Gaswerk befanden sich
Fabriken wie z.B. eine Gaszählerfabrik, Askania mit
einem Werk und die Theis AG, diese wurden von der
Bahn mitbedient. Nach dem Kriege befanden sich dort zeitweilig der Fruchthof und der
Fleischgroßmarkt für Westberlin in den ehem. Askania
Werken und auch ein Postamt. Auf ganz alten Karten
wird die Lage des Gaswerkes im Dreieck oberhalb des
Teltow-Kanals angegeben. Dort befand sich jedoch nur
die Villa der Direktion, Sie wurde ein Opfer des II.
Weltkrieges und auf dem Gelände entstand Ende der
50er Jahre eine Reihenhaussiedlung und eine
Kleingartenkolonie. Vor dem Kanal wurde ein
Grünstreifen zur Erholung angelegt |
|

Diesellok der
Gasag |

Speicherlok |

C n2t 1901 Preuß.
T 3 Maffei-Schwarzkopff 3019 sie steht jetzt
im DTMB |
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

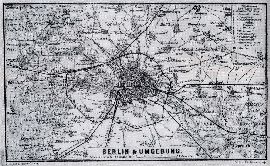
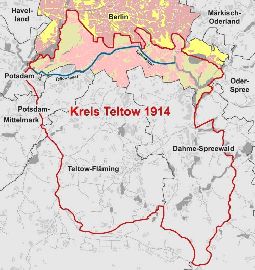




.jpg)
.jpg)
.jpg)
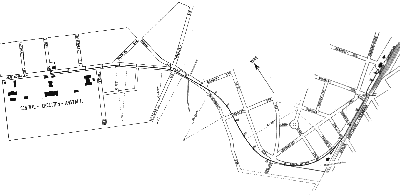

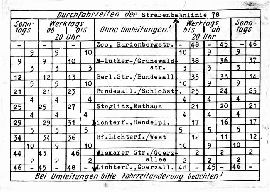
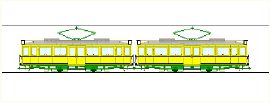
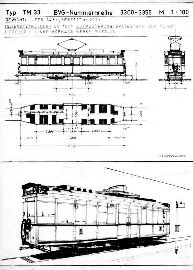




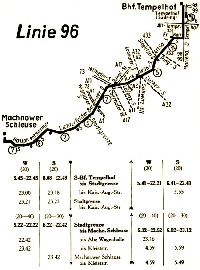

%20(01).jpg)
.jpg)
.jpg)
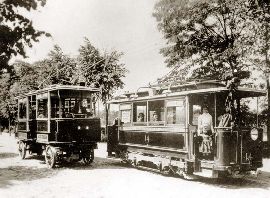
_1973_MiNr_447.jpg)
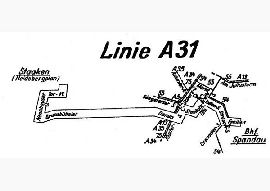
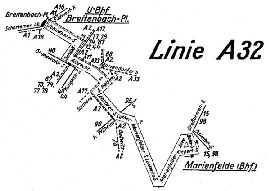
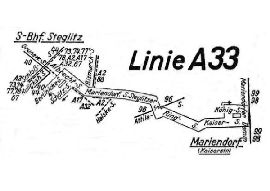

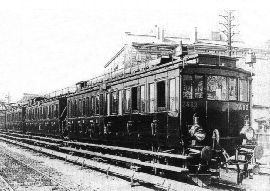

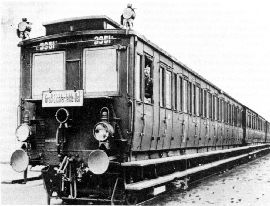
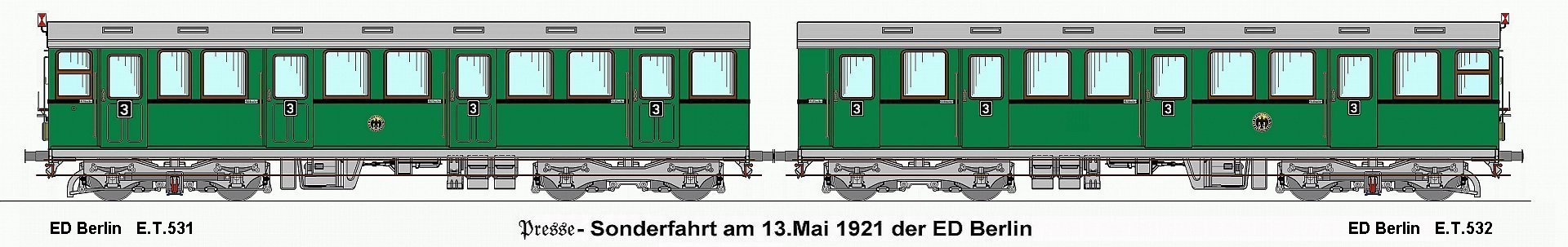
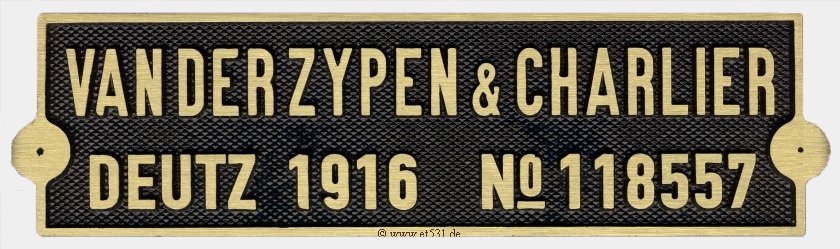
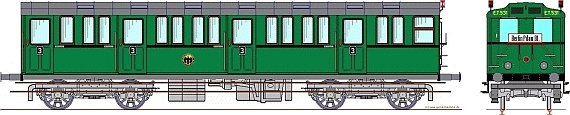

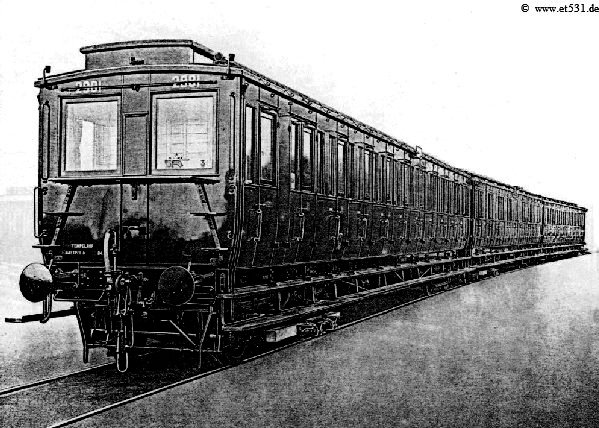
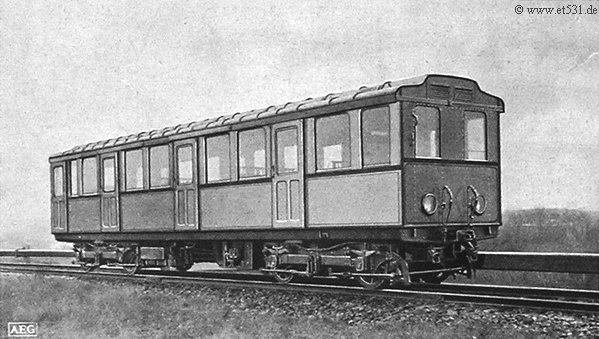
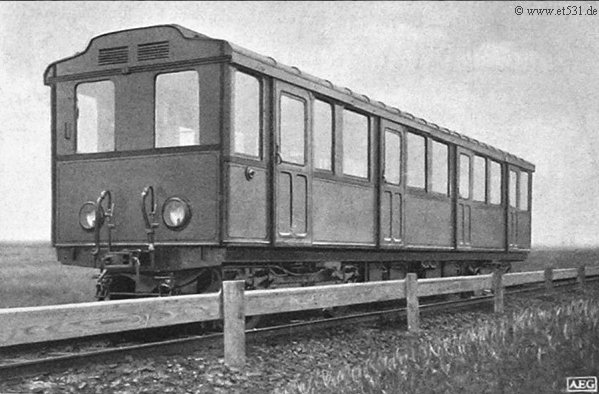
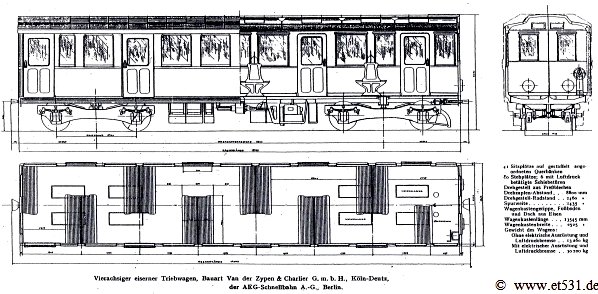
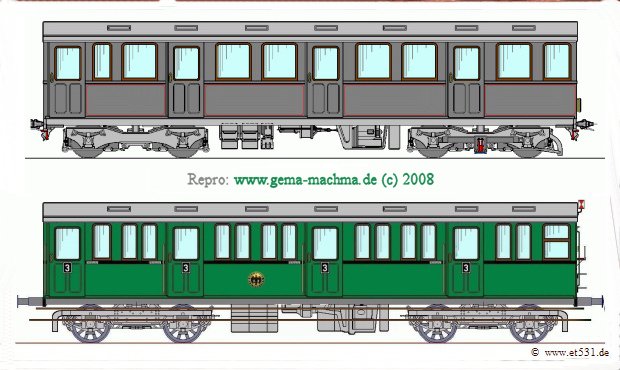
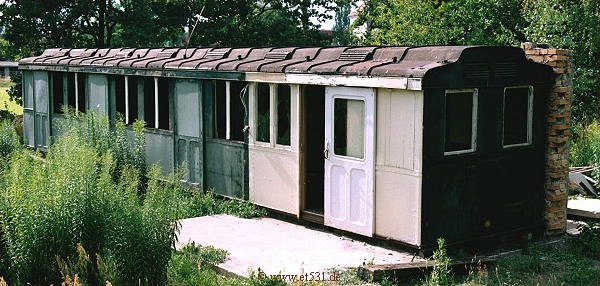




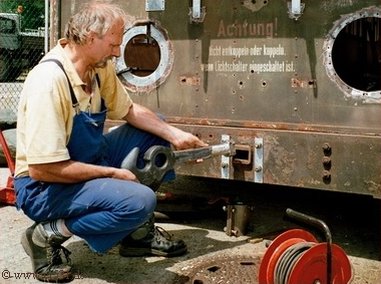






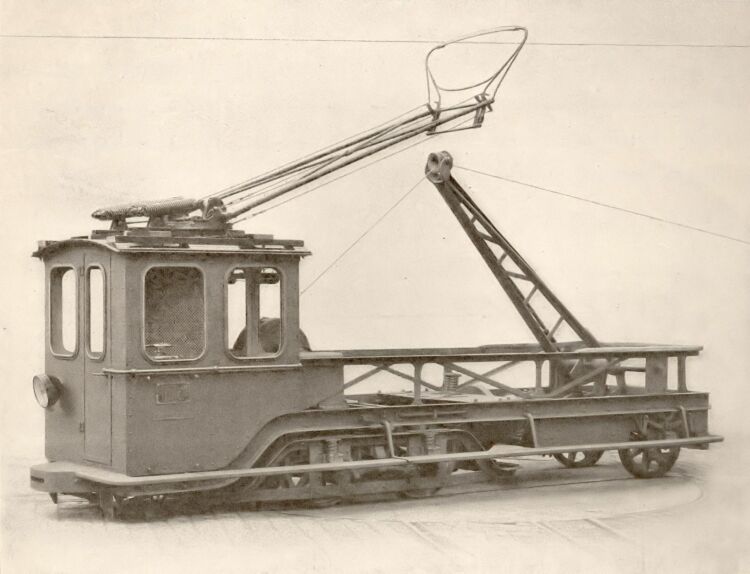


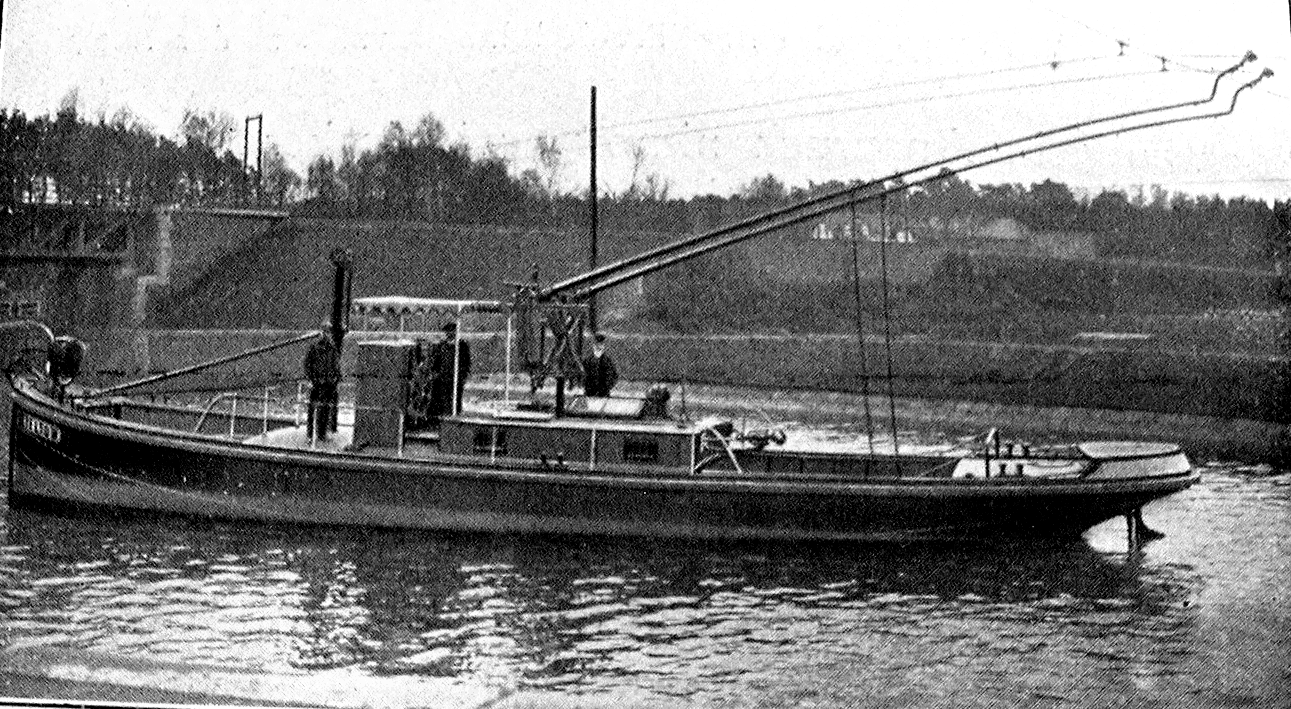

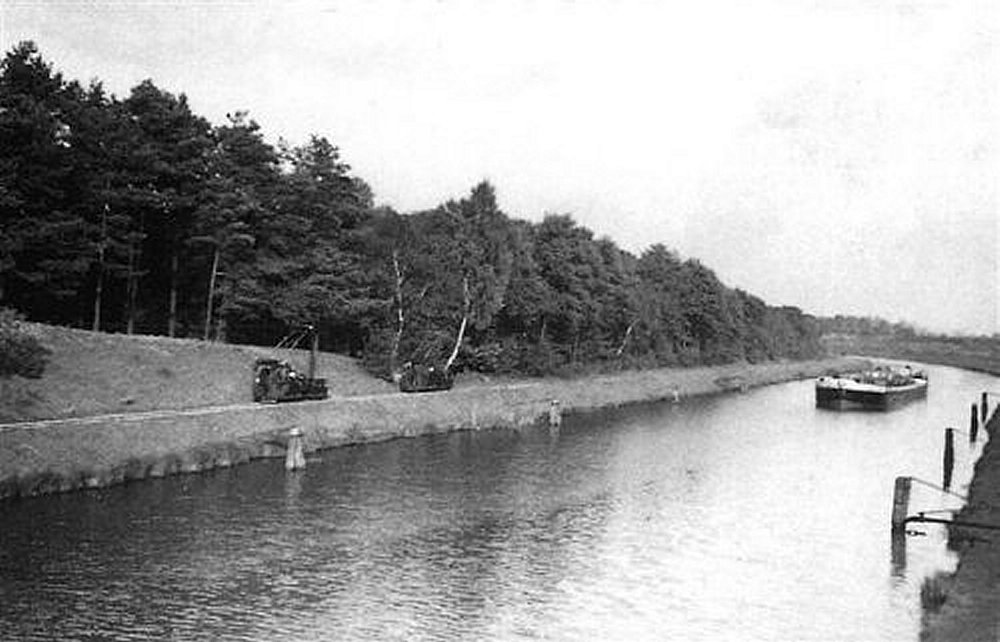









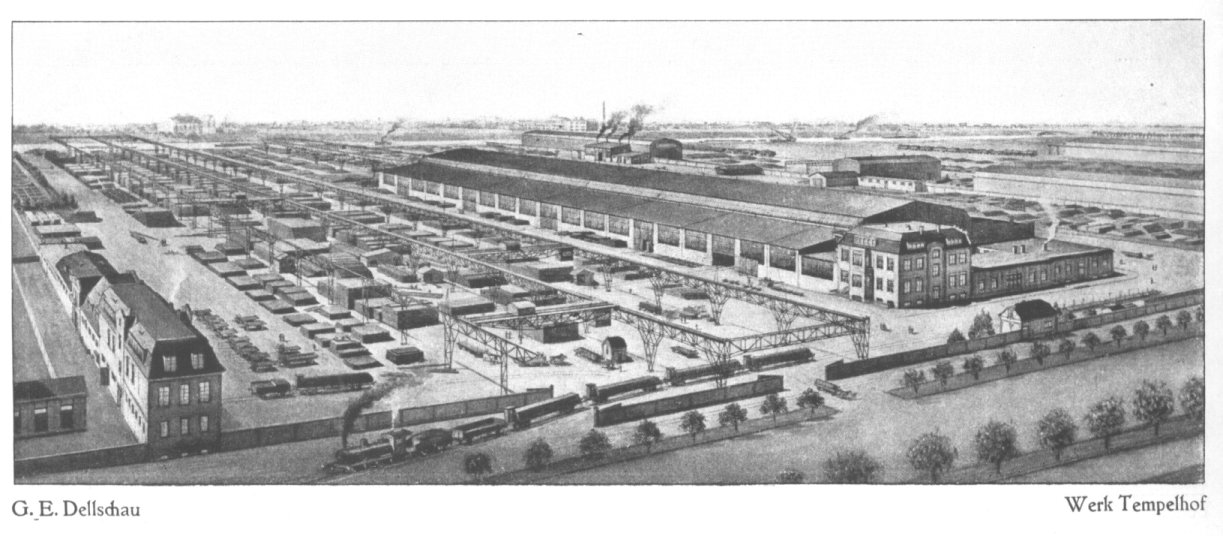
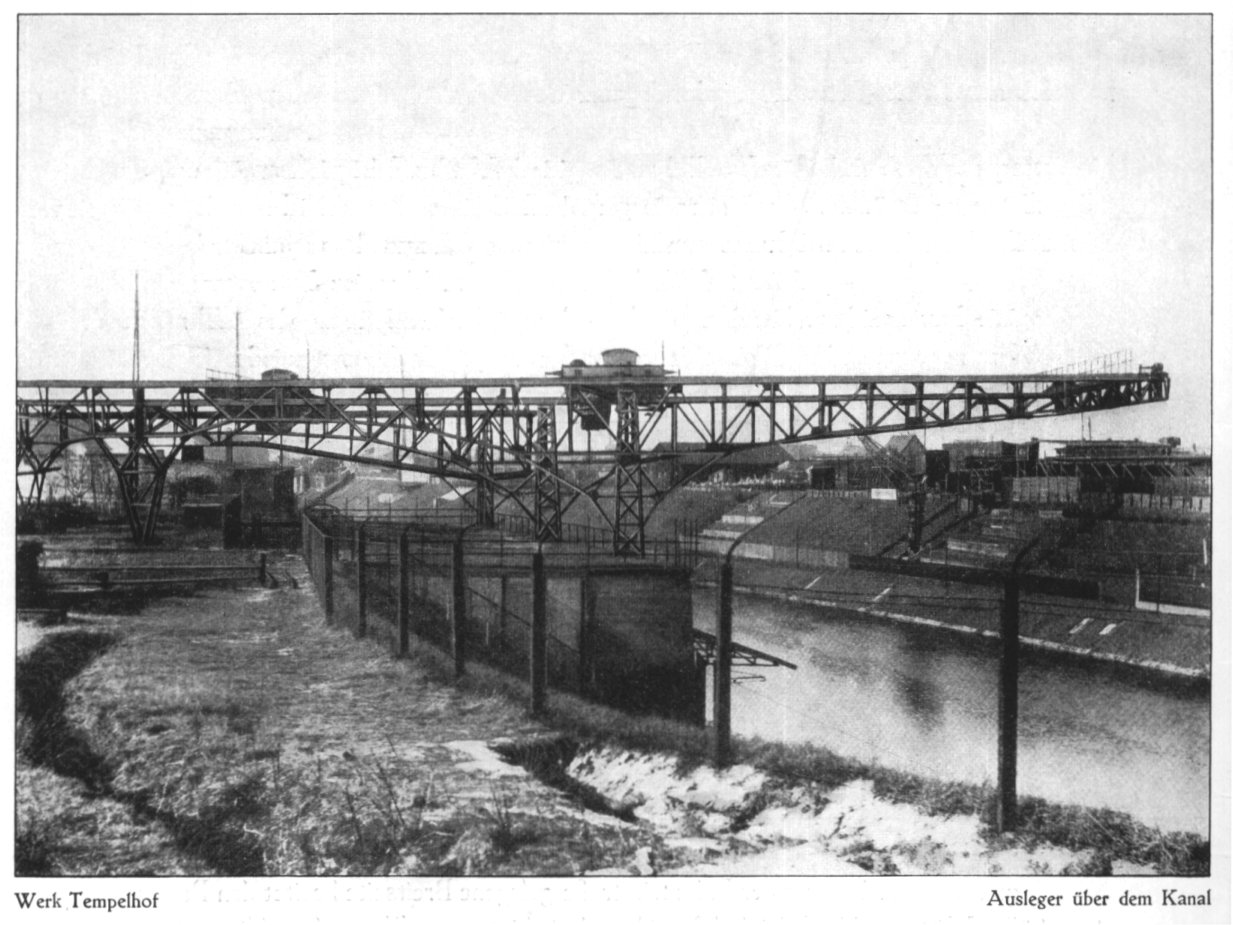
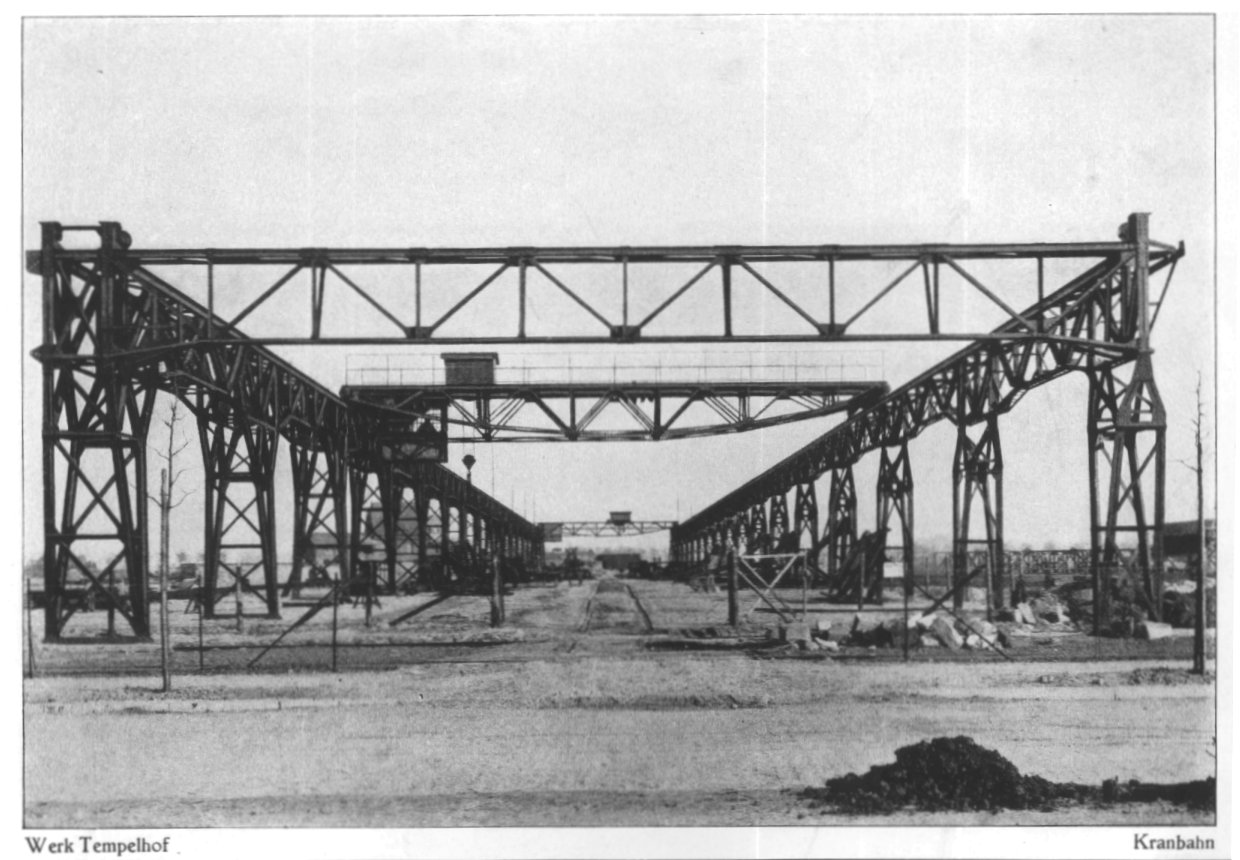
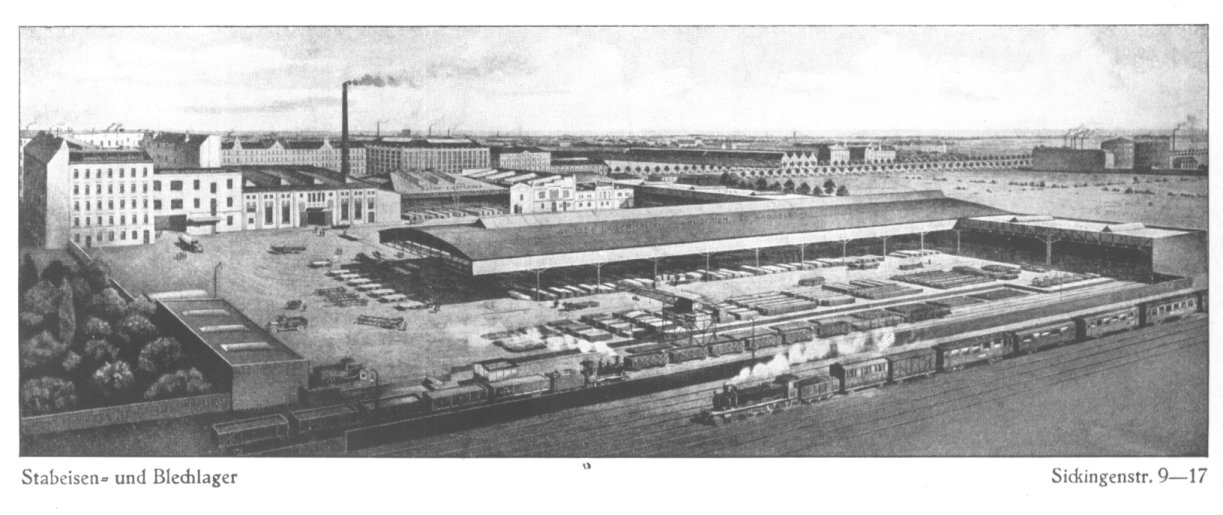
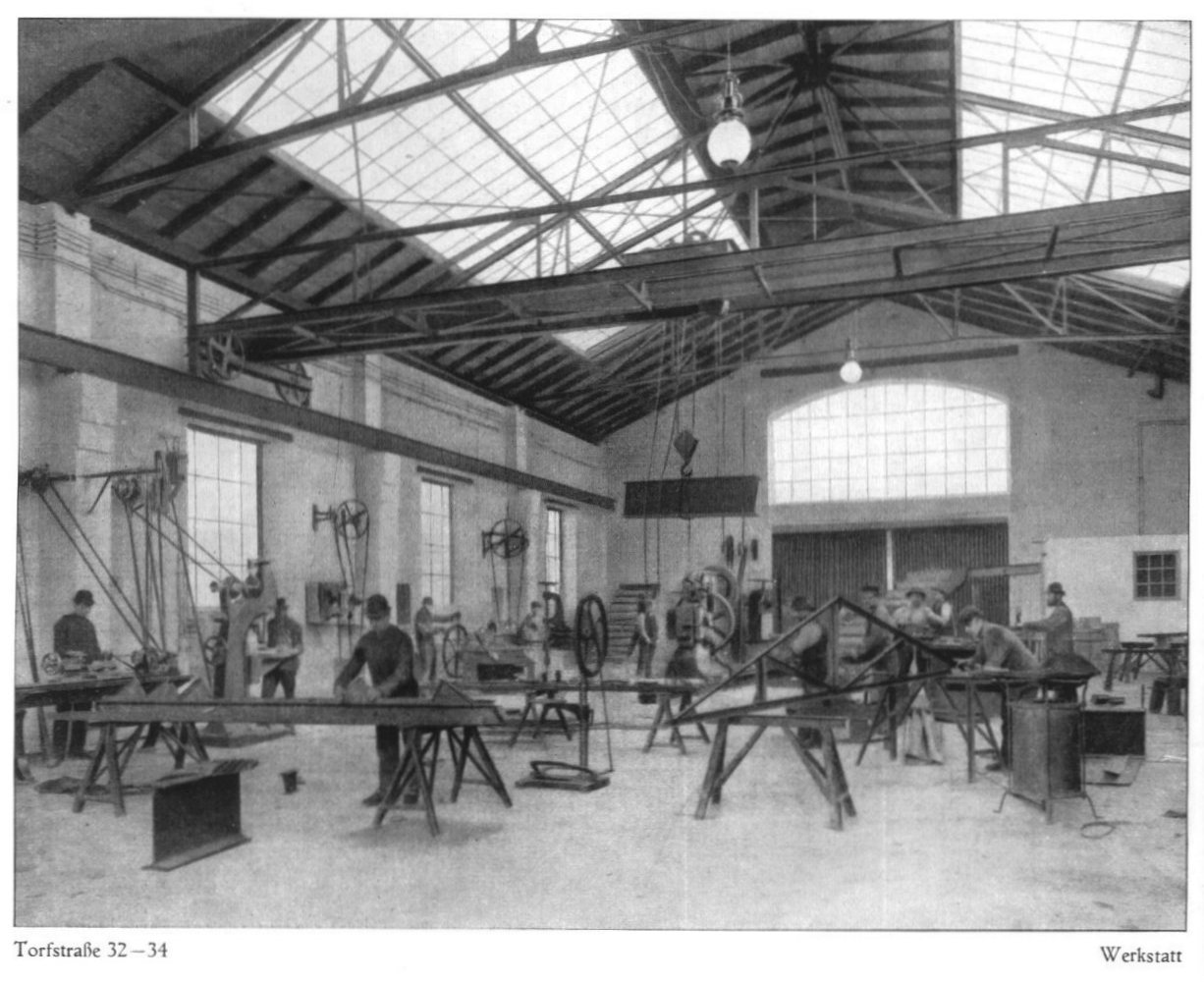
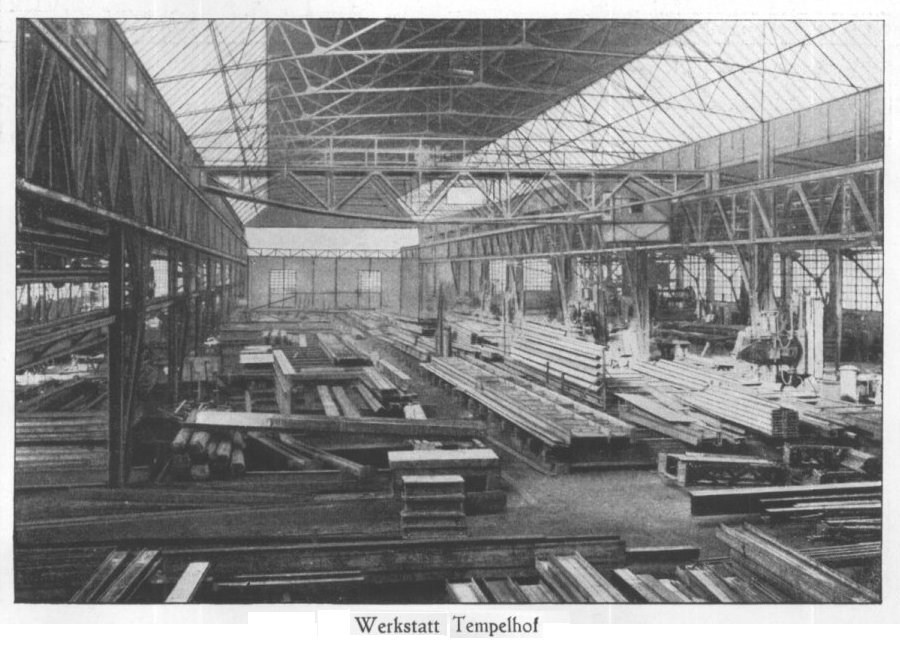



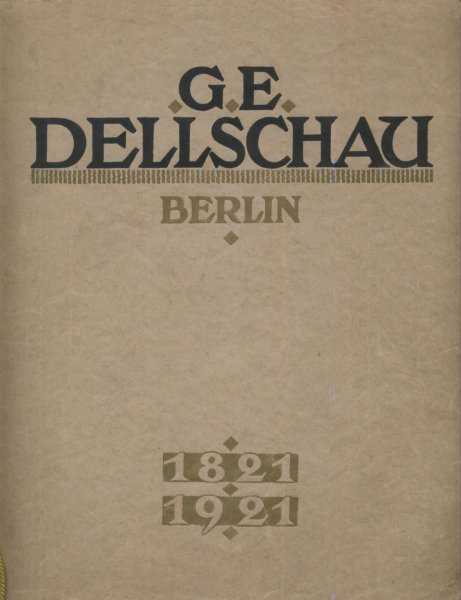
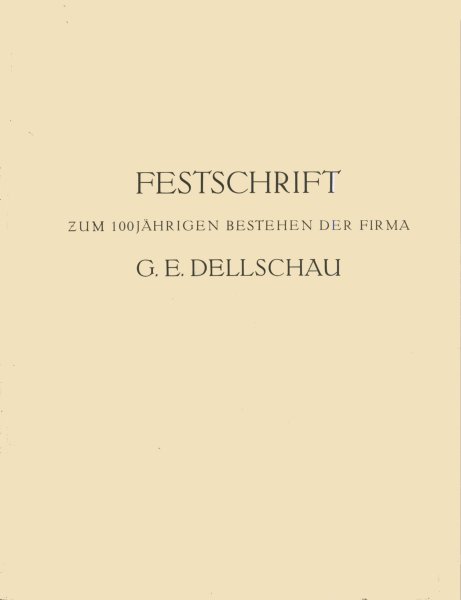
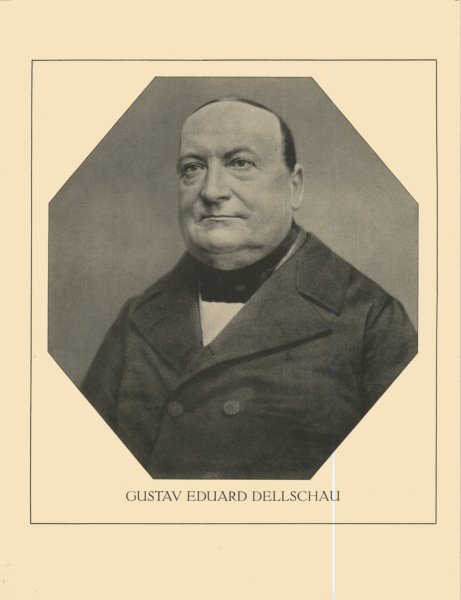
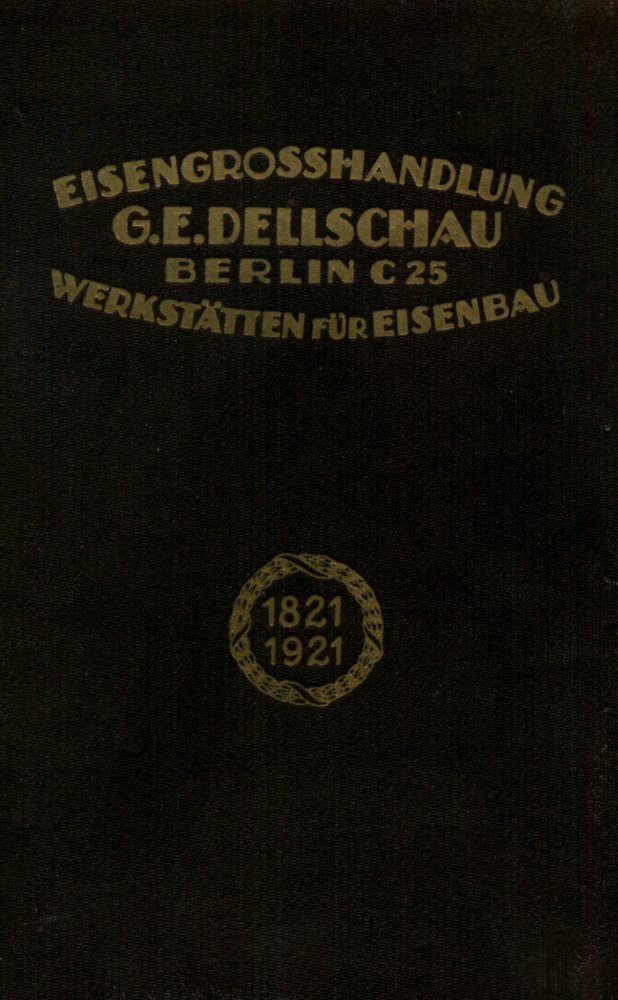
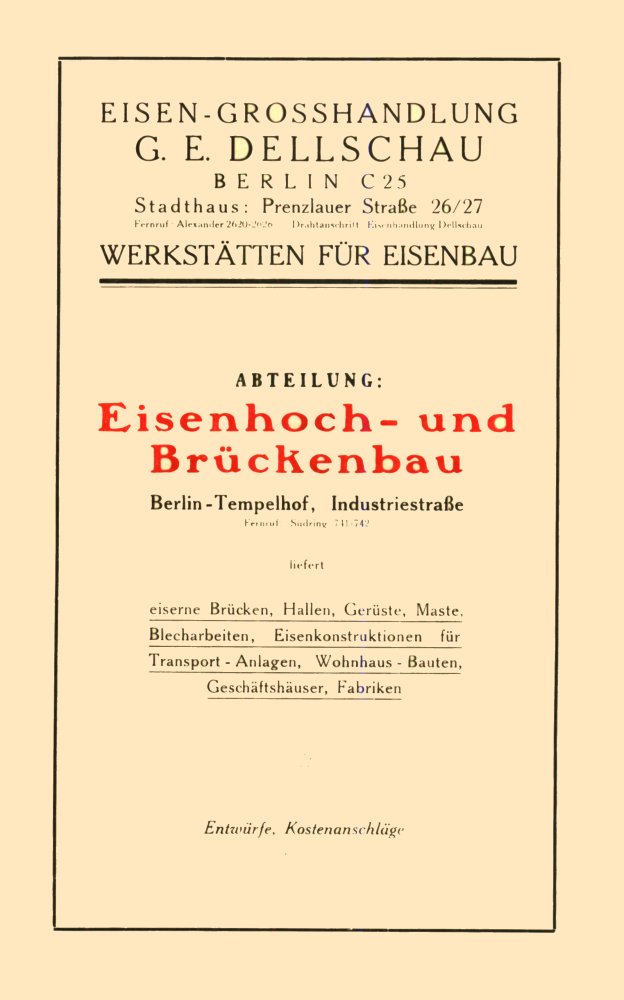
.jpg)
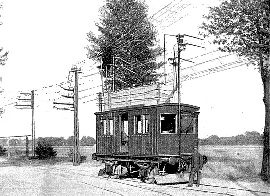
.jpg)
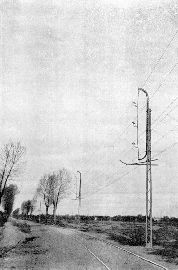
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

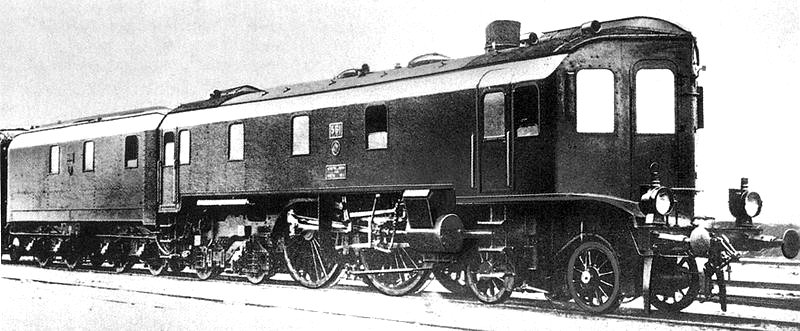
.jpg)
.jpg)












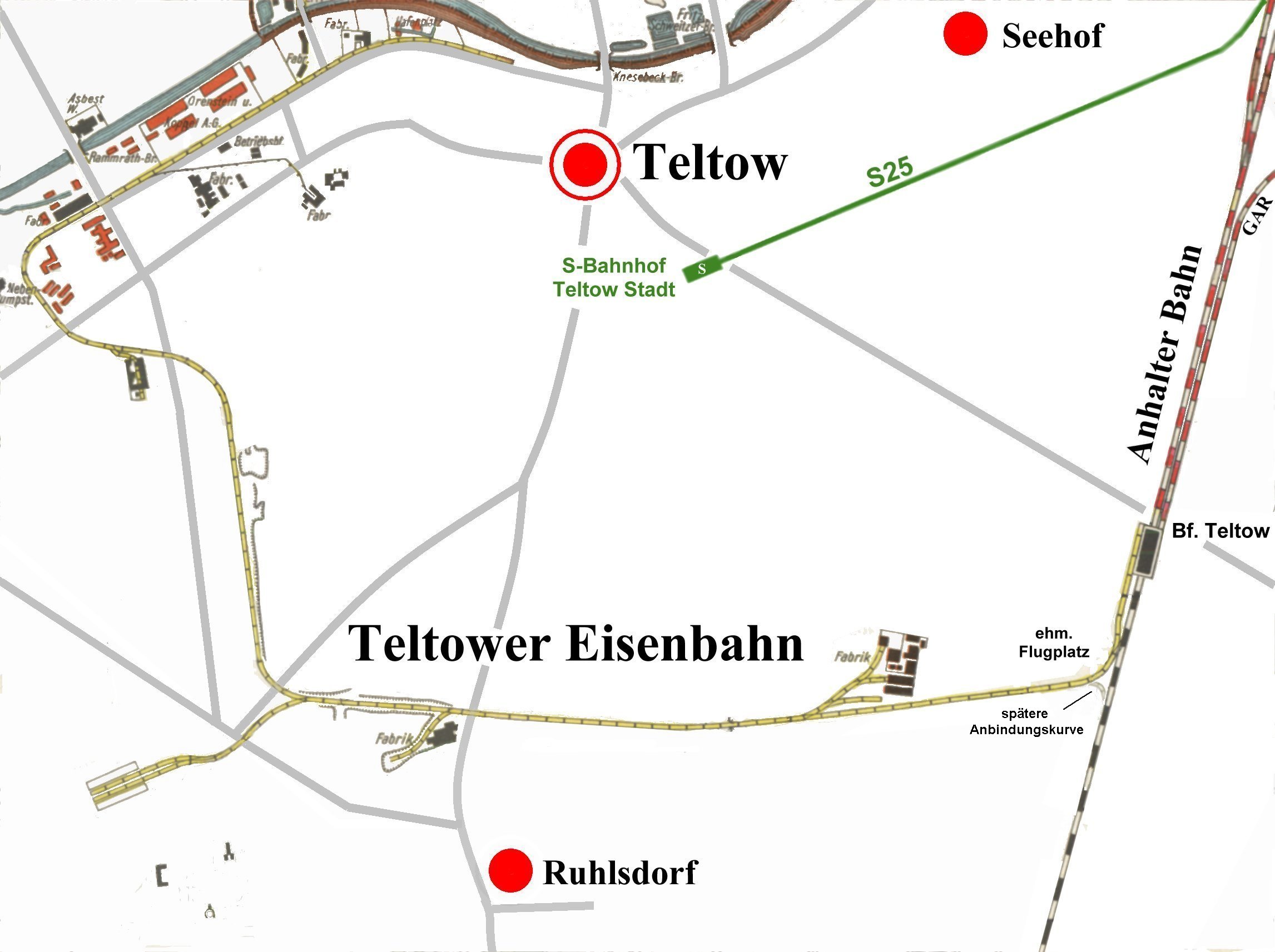
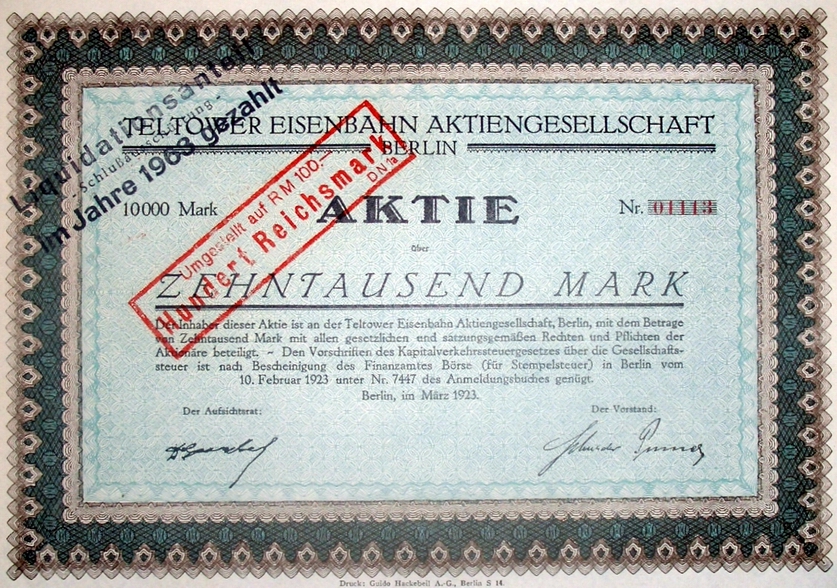
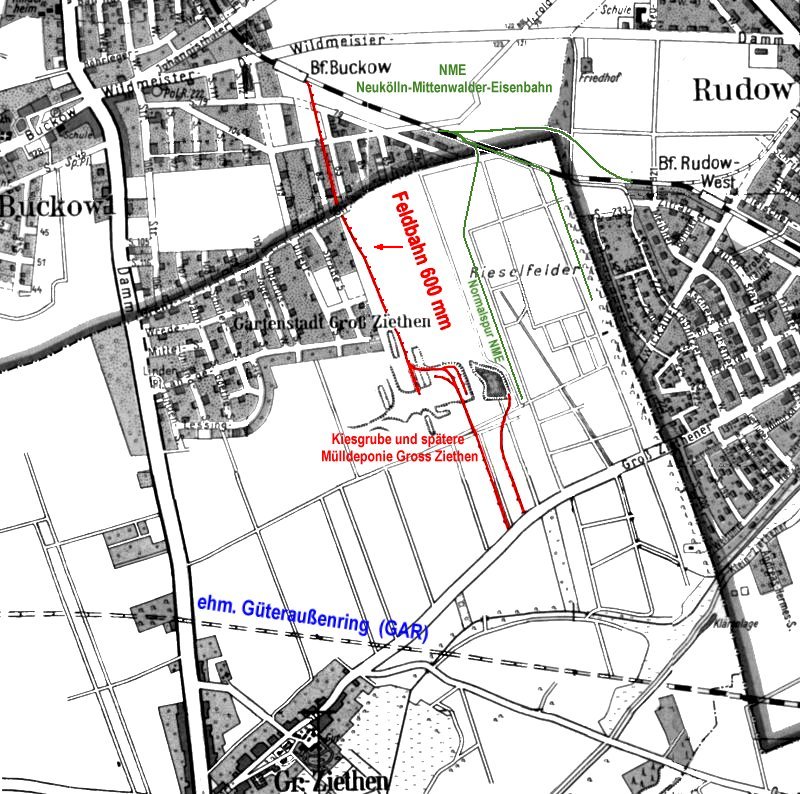
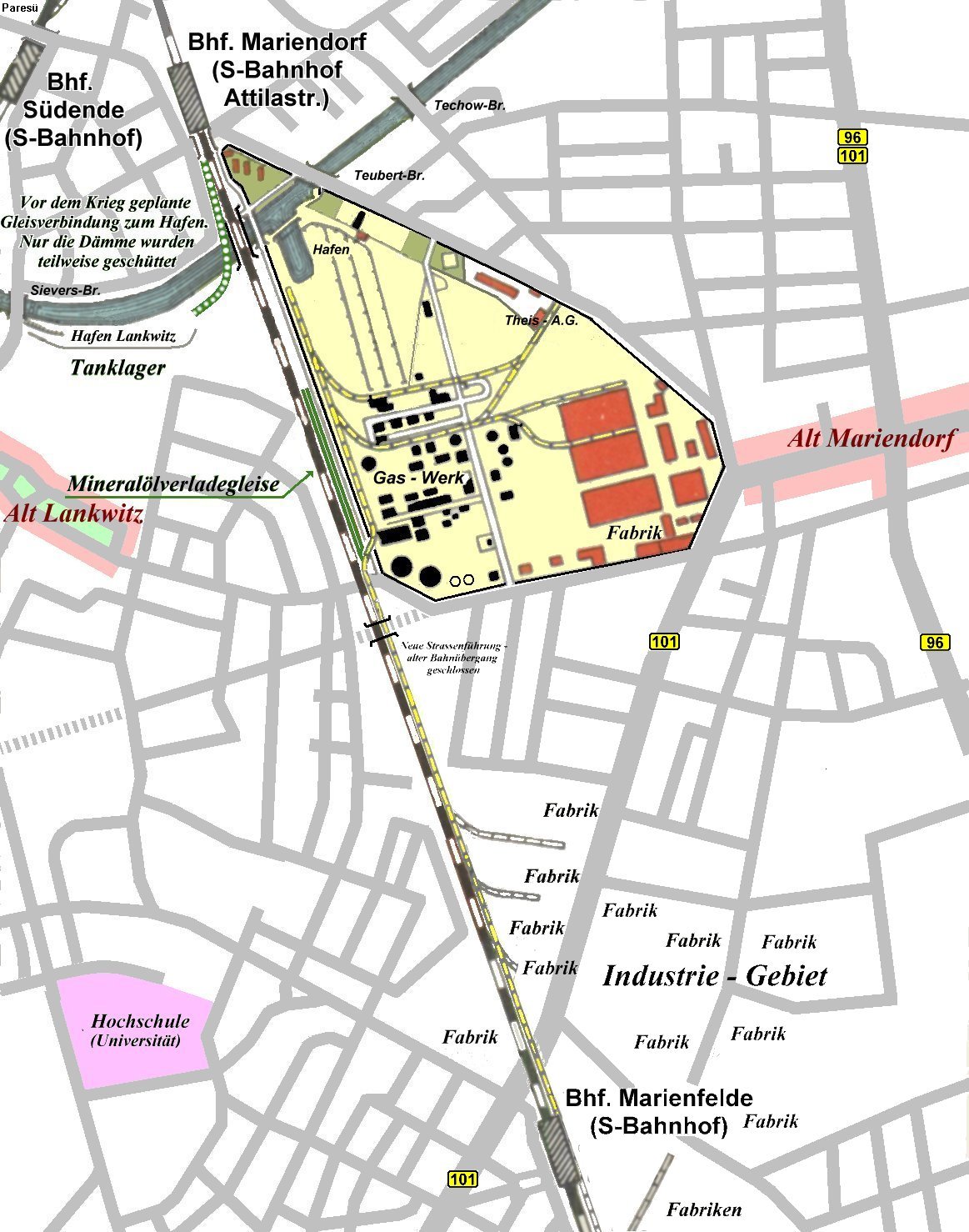
.jpg)




